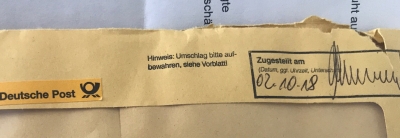Mein Berliner Kollege Carsten R. Hoenig schaut in seinem Blog auf den NSU-Prozess in München. Konkret geht es den „Antrag“, welchen die Wahlverteidiger von Beate Zschäpe ans Schluss ihrer Plädoyers gestellt haben. Zehn Jahre Freiheitsstrafe halten die Anwälte bei ihrer eigenen Mandantin für angemessen, eine Verurteilung wegen Mordes ( = lebenslänglich) aber nicht.
Darf ein Anwalt eine Freiheitsstrafe für seinen Mandanten „fordern“? Das eher nicht, aber im Sinne eines dringenden Wunsches haben es Zschäpes Verteidiger sicher auch nicht formuliert. Anders als Carsten meine ich aber schon, dass auch ein Verteidiger sich zu einem Strafmaß äußern kann und sogar soll – zumindest wenn eine Verurteilung aus sachlichen Gründen zu erwarten ist.
Vornehme Zurückhaltung in dem Bestreben, dem Mandanten nicht zu schaden, zahlt sich nach meiner Erfahrung nämlich am Ende gar nicht positiv aus. Die Situation ist ähnlich, wie wenn man als Verteidiger mit der Staatsanwaltschaft oder dem Gericht vor oder während der Verhandlung (informell) über einen Deal spricht. Auch hier ist es fast immer sinnvoll, wenn der Anwalt als erster eine konkrete, im Idealfalls natürlich nicht ganz zu absurde Vorstellung äußert.
Das ergibt sich aus dem sogenannten Ankereffekt. Wer als erster eine konkrete Zahl oder einen akzeptablen Rahmen nennt, beeinflusst sein Gegenüber damit regelmäßig in seine Richtung. Er manipuliert die Verhandlungsgrundlage sogar dann, wenn die Gegenseite widerspricht. So ganz kann sich nämlich auf der unterbewussten Ebene niemand dem Sog entziehen, den ein solches Commitment mit sich bringt. Das gilt gerade auch gegenüber ehrenamtlichen Richtern, die ja zu 99 % ihrer Lebenszeit nicht über das richtige Strafmaß für einen Angeklagten grübeln.
Der Ankertrick funktioniert natürlich nicht nur im juristischen Bereich, sondern in so gut wie allen Lebenssituationen. Man muss halt möglicherweise etwas über den eigenen Schatten springen, wenn man eher zurückhaltend ist. Wobei das jetzt nicht auf den Kollegen Hoenig gemünzt ist, denn den kenne ich alles andere als schüchtern.