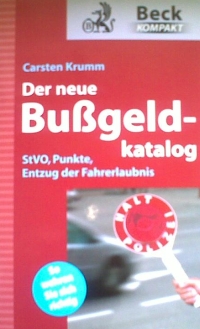Die Zeiten ändern sich und damit auch die Technik. Das haben, je nach Alter und Dünkel, selbst Richter und Staatsanwälte lust- oder leidvoll erfahren. Es gibt inzwischen viele Angehörige dieses Berufsstands, die ihre Anklagen oder Urteile nicht mehr diktieren, sondern selber in den Computer tippen. Das wird langsam aber sicher, landauf, landab zur Gewohnheit werden.
Landauf, landab? Nein! Nicht so im Ruhrgebiet. In Bochum sitzt ein unbeugsamer Handelsrichter und leistet seit vier Jahren Widerstand. Gegen die Arbeit am PC-Bildschirm. Der Mann pocht auf sein Recht auf Papier. Auf Akten. Auf Berge davon. Gegen den Willen der Landgerichtspräsidentin.
Wenn es unter Richtern Knatsch gibt, urteilen Richter darüber. Und wenn ein Richter sich weigert und deshalb andere Richter gegen Richter entscheiden, dann kann in der Justiz schon mal die modernste Erfindung sinnlos werden. Allerdings muss vorher der ordentliche Beschwerdeweg „erschöpft“ sein. Dieses Wort nehmen Juristen in den Mund, wenn sie meinen: innerhalb der Behörden, auch der vorgesetzten, läuft gar nichts mehr.
So ist es in diesem Fall. Der begann mit dem Einzug des elektronischen Handelregisters. Und endete vorläufig vor gut zwei Jahren mit einem bemerkenswerten Urteil des nordrhein-westfälischen Dienstgerichts in Düsseldorf. Das moderne Handelsregister wurde Anfang 2007 mit Begeisterung aufgenommen und kürzlich noch einmal ausführlich gelobt. Mit dem Gesetz über das elektronische Handelsregister habe es eine „wichtige Weichenstellung“ gegeben, betonte die nordrhein-westfälische Justizministerin Roswitha Müller Piepenkötter (CDU).
Allein im Jahr 2007 wurden rund 800.000 elektronische Anträge rechtsverbindlich elektronisch eingereicht. Allerdings hapert es mit deren Bearbeitung. Jedenfalls erstmal beim Amtsgericht in Bochum. Dort bat ein Richter, und das klang zunächst völlig harmlos, die Geschäftstelle des Handelsregisters möge ihm die Anträge doch einmal ausdrucken. Er wolle zuhause damit in Ruhe und ordentlich arbeiten.
Der Mann trat mit seinem simplen Wunsch – absichtlich oder arglos – eine juristische Lawine los. Zunächst verwehrte der Amtsgerichtsdirektor die Ausdrucke. Die Einführung des elektronischen Handelsregisters bezwecke, so erklärte der Chef, den Verfahrensablauf in jeder Hinsicht zu optimieren und überflüssigen Arbeits- und Kostenaufwand zu vermeiden. Außerdem: Mit Blick auf die erfolgten Sparerfolge sei den Gerichten weniger Personal zugewiesen worden.
Die gewünschten Ausdrucke würden jedoch das Gegenteil bewirken, nämlich einen erheblichen Aufwand an Arbeitszeit und Kosten verursachen. Der brüskierte Richter rief (wir sind in der zweiten Phase) die Präsidentin des Landgerichts Bochum und damit die nächste Instanz an. Er legte nach. Der Bescheid des Amtsgerichtsdirektors sei ein Eingriff in seine richterliche Unabhängigkeit. Die Arbeit am Computer-Bildschirm, machte der Richter geltend, sei deutlich konzentrationsmindernd und führe zu Ermüdungserscheinungen.
Da brauche er Pausen. Ohne Ausdrucke, ließ er kategorisch wissen, gebe es keine optimale Sachbearbeitung. Doch auch die Landgerichtspräsidenten ließ ihren Kollegen abblitzen. Ihm werde eine bestimmte Arbeitsweise weder vorgeschrieben noch untersagt. Er könne ja, kam da noch ein konstrunktiver Hinweis, die Eingänge selbst ausdrucken. Diesen Schlenker hielt der Richter gar für „rechtswidrig“ und wandte sich – Phase drei – an den Präsidenten des Oberlandesgerichts Hamm.
Es entspreche doch der richterlichen Unabhängigkeit, die Art der Bearbeitung selbst zu wählen. Der Päsident bemühte seufzend den Gesetzgeber. Dessen Absicht, nämlich die elektronische Beschleunigung und Vereinfachung des Handelsregisters, werde mit Ausdrucken durch Justizbeschäftigte unterlaufen.
Damit war der Beschwerdeweg zwar erschöpft, nicht aber der Richter. Er brachte den Fall nun vor das nordrhein-westfälische Dienstgericht für Richter in Düsseldorf. Dort trug er vor, dass es jedem Richter überlassen bleiben muss, ob er an einem PC arbeitet oder nicht.
Und endlich: Das Dienstgericht begründete auf 11 Seiten, warum es den Ruhrgebietskollegen im Recht sieht. Der Kernsatz ist ein Meisterwerk juristischer Prosa und klingt einleuchtend: „Die grundsätzliche Zulässigkeit, der Richterschaft eine neue Technik zur Verfügung zu stellen, findet ihre Entsprechung aber nicht in einer ausnahmslos gegebenen Pflicht des Richters, diese Technik auch tatsächlich zur Anwendung zu bringen“.
Fazit: Ein deutscher Richter muss weder am Bildschirm arbeiten noch eigenhändig irgendetwas ausdrucken. Jetzt kann es zu dem kommen, vor dem sich schon der Amtsgerichtsdirektor gruselte. Arbeitszeit und Kosten für die Ausdrucke steigen; bei jedem Antrag spuckt der Drucker mindestens zwanzig Seiten aus; bei komplizierten Vorgängen werden es leicht zweihundert bis dreihundert. „Aufgeblähte“ Akten würden weitere Archivräume notwendig machen, die es nicht gibt.
Falls doch, würden noch mehr Kosten verursacht. Was umso mehr gelte, wenn weitere Richter des Handelsregisters in ähnlicher Weise verfahren wollten. Ein Dammbruch? Womöglich, denn ähnlich hat kürzlich das Dienstgerichtshof am Oberlandesgericht Hamm per Beschluss bestätigt: „Aus der Unabhängigkeit des Richters folgt, das dieser seine Arbeit grundsätzlich nach Maßgabe seiner individuellen Arbeitsgestaltung verrichten kann. Wobei es Sache der Justizverwaltung ist, ihm hierfür die sachlichen Voraussetzungen zur Verfügung zu stellen“.
Wörtlich heißt es weiter: „Hierzu zählt auch die Vorlage papierner Ausdrucke von elektronischen Eingaben“. Die nächste Instanz ist das Dienstgericht beim Bundesgerichtshof. In welche Richtung dessen Entscheidung gehen kann, ist schon jetzt absehbar. Das Recht ist zwar für alle gleich. Nur für Richter ein bisschen gleicher.
Die Kosten des gesamten Verfahrens? Tragen die Steuerzahler. (pbd)