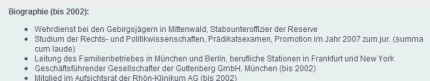Solches Leben kann einem Spießrutenlauf gleichen: Häftlinge in nordrhein-westfälischen Gefängnissen, die schon mit einer HIV-Infektion oder einer Aids-Erkrankung gestraft sind, müssen diese Krankheit auch noch offenbaren – es sei denn, sie wollen ihre Haft einsam in einer Einzelzelle absitzen.
Sobald sie aber Kontakt zu anderen Häftlingen haben wollen, zu Gesprächen etwa oder einem Kartenspiel, werden sie vom Justizministerium zur Preisgabe der Infektion genötigt. Diese „Zwangsouting“, so prangert es Winfried Holz vom Vorstand der Deutschen AIDS-Hilfe e.V. (DAH) an, sei eine „Missachtung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung durch die Landesregierung“.
Inzwischen hat das heikle Thema auch den Landtag erreicht. Der soll beschließen, so ein Antrag des FDP-Rechtsexperten Robert Orth, die bestehende „Diskriminierung mit sofortiger Wirkung aufzuheben“.
Das Justizministerium verschanzt sich derweil hinter selbst geschriebenen Verwaltungsvorschriften.
Diese Regeln sollen Mitgefangene und Bedienstete der Justizvollzugsanstalten schützen. Dahinter steckt folgendes Argumentationsmuster: Die Spritze des Arztes ist eine Körperverletzung, ebenso der Haarschnitt eines Frisörs bei einem Kunden. Beide Berufsgruppen machen sich nur deshalb nicht strafbar, weil der Patient, der Kunde einverstanden ist. Juristen nennen so was einen Rechtfertigungsgrund. Das Justizmnisterium fordert eine derartige „Einwilligung“ auch von allen, die mit HIV-Infizierten Gefangenen zusammen sind.
Nachdem sich ein Häftling auf einem Formular zur Infektion bekennt, muss der andere Gefangene stets seine Einwilligung zum persönlichen Kontakt unterschreiben. Fürsorge für alle Beteiligten? Nur vermeintlich, so behauptet es die FDP in ihrem Antrag: „Der angestrebte Schutz wird durch diese Regelung nicht erreicht.“ Denn es sei klar, dass HIV in alltäglichen sozialen Kontakten eben nicht übertragen wird, auch nicht beim Husten oder Niesen, nicht bei der Krankenpflege und auch nicht in Saunen oder Schwimmbädern.
Die Aidshilfe: „HIV ist ein schwer übertragbarer Erreger, Schutz vor HIV-Übertragungen bieten etwa Kondome – und hier ist NRW eigentlich fortschrittlich, denn in den Haftanstalten kommt man leicht und anonym an dieses Schutzmittel heran.“
Davon war keine Rede, als die einst heroinabhängige Duisburgerin Katja S., ledige Arbeiterin, wegen etlicher Betrügereien in die JVA Dinslaken kam. Aber ins Gerede kam sie angeblich sofort – es geht um einen zweiten wunden Punkt im Datenschutz: „Ich war in Einzelhaft. An meiner Zellentür war ein roter Punkt. Alle wussten: Ich bin HIV-positiv.“
Den roten Punkt bestreitet das Justizministerium. Aber: „Eine Information ist zulässig, soweit dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer anderen Person erforderlich ist.“ Dass heißt: Wenn nicht bereits Kriminalbeamte während ihrer Ermittlungen die Krankheit schriftlich festgehalten haben, „unterrichtet der Anstaltsarzt den Anstaltsleiter unverzüglich, wenn die Blutuntersuchung des Gefangenen ein positives Ergebnis erbracht hat“. Der Gefängnisleiter wiederum nformiert „nach Erfordernis“ seine Mitarbeiter. Diese unterlägen ja der Schweigepflicht.
Schweigepflicht im Knast? Die verletze schon der Arzt, kritisiert Bärbel Knorr von der Deutschen Aidshilfe. Die Gefängnisärzte machten sich strafbar, sagt der Liberale Robert Orth. Wie viele Kranke in den Gefängnissen mit erkennbar oder unsichtbarem „Zwangsouting“ leben müssen, weiß das Justizministerium auch auf Anfrage nicht. Fest steht: Sie müssen.
„Diese Praxis gibt es nur in Nordrhein-Westfalen“, unterstreicht Bärbel Knorr. „Die Folge kann sein, dass sich Gefangene nicht auf HIV testen oder behandeln lassen.“ Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich Mithäftlinge in falscher Sicherheit wiegen und auf Schutzmaßnahmen verzichten.
Rüdiger Wächter ist Sozialpädagoge in Duisburg. Er kennt die tägliche Praxis. „Die Häftling sollten sich besser selbst schützen“, sagt er, „statt irgendwelche Erklärung zu unterschreiben“. Die Haltung des Justizministeriums sei eine Farce. Zwar werde niemand zur Unterschrift gezwungen. Wer sie aber verweigert, darf nicht mehr am Knastleben teilnehmen, muss die Tage und Nächte allein in seiner Zelle hocken – an der womöglich ein roter Punkt klebt. (pbd)