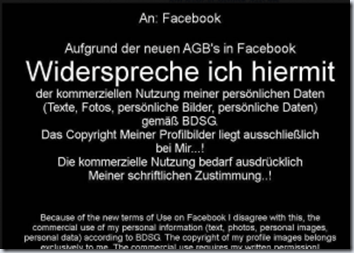Eine Person in einem Internetforum während einer Diskussion als „rechtsradikal“ zu betiteln, ist ein Werturteil und grundsätzlich von der Meinungsfreiheit gedeckt. Dies entschied das Bundesverfassungsgericht in einem heute veröffentlichten Beschluss.
Der klagende Rechtsanwalt beschäftigte sich auf seiner Kanzleihomepage und in Zeitschriftenveröffentlichungen mit politischen Themen. Er schrieb unter anderem über die „khasarischen, also nicht-semitischen Juden“, die das Wirtschaftsgeschehen in der Welt bestimmten, und über den „transitorischen Charakter“ des Grundgesetzes, das lediglich ein „ordnungsrechtliches Instrumentarium der Siegermächte“ sei.
Der Beschwerdeführer, ebenfalls Rechtsanwalt, setzte sich in einem Internet-Diskussionsforum mit diesen Veröffentlichungen auseinander: Der Verfasser liefere „einen seiner typischen rechtsextremen originellen Beiträge zur Besatzerrepublik BRD, die endlich durch einen bioregionalistisch organisierten Volksstaat zu ersetzen sei“. Wer meine, „die Welt werde im Grunde von einer Gruppe khasarischer Juden beherrscht, welche im Verborgenen die Strippen ziehen“, müsse „es sich gefallen lassen, rechtsradikal genannt zu werden“.
Das Landgericht und das Oberlandesgericht verurteilten den zweiten Rechtsanwalt zur Unterlassung der Äußerungen, wobei das Landgericht sie teilweise als unwahre Tatsachenbehauptungen und das Oberlandesgericht sie als Schmähkritik aus dem Schutzbereich der Meinungsfreiheit herausfallen ließen.
Das Bundesverfassungsgericht hat beide Urteile aufgehoben und die Sache an das Landgericht
zurückverwiesen. Die Urteile verletzen nach Auffassung der Karlsruher Richter nämlich den Beschwerdeführer in seinem Grundrecht auf Meinungsfreiheit.
Das Gericht nennt folgende Argumente:
Es handelt sich um Meinungsäußerungen in Form eines Werturteils, denn es ist nicht durch eine Beweiserhebung festzustellen, wann ein Beitrag „rechtsextrem“ ist, wann sich ein Denken vom „klassisch rechtsradikalen verschwörungstheoretischen Weltbild“ unterscheidet und wann man „es sich gefallen lassen muss, rechtsradikal genannt zu werden“.
Bedeutung und Tragweite der Meinungsfreiheit werden verkannt, wenn eine Äußerung unzutreffend als Tatsachenbehauptung, Formalbeleidigung oder Schmähkritik eingestuft wird mit der Folge, dass sie dann nicht im selben Maß am Grundrechtsschutz teilnimmt wie Äußerungen, die als Werturteil ohne beleidigenden oder schmähenden Charakter anzusehen sind.
Verfassungsrechtlich ist die Schmähung eng definiert, da bei ihrem Vorliegen schon jede Abwägung mit der Meinungsfreiheit entfällt. Eine Schmähkritik ist nicht einfach jede Beleidigung, sondern spezifisch dadurch gekennzeichnet, dass nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Dies kann hier aber nicht angenommen werden, denn alle Äußerungen haben einen Sachbezug.
Verfassungsrechtlich geboten war also eine Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers und dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht des Unterlassungsklägers. Das Ergebnis dieser Abwägung hängt von den Umständen des Einzelfalls ab.
In der Abwägung muss nun das Gericht, an das zurückverwiesen wurde, berücksichtigen, dass
der Unterlassungskläger weder in seiner Intim- noch in seiner Privatsphäre betroffen ist, sondern allenfalls in seiner Sozialsphäre. Dagegen ist die Meinungsfreiheit des Beschwerdeführers in ihrem Kern betroffen. Die Verurteilung zur Unterlassung eines Werturteils muss im Interesse des Schutzes der Meinungsfreiheit auf das zum Rechtsgüterschutz unbedingt Erforderliche beschränkt werden. Der Unterlassungskläger hat seine Beiträge öffentlich zur Diskussion gestellt; dann muss zur öffentlichen Meinungsbildung auch eine inhaltliche Diskussion möglich sein.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17. September 2012, 1 BvR 2979/10