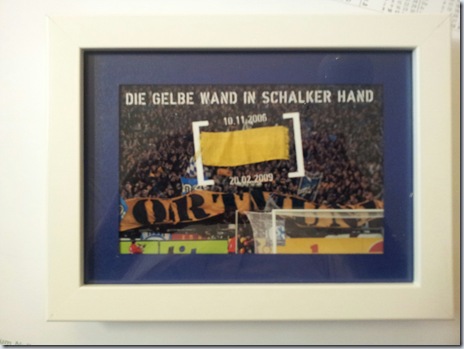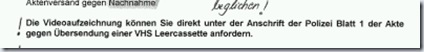Bei der Jagd nach Geschwindigkeitssündern gilt für die Polizei kein “Vier-Augen-Prinzip”. Das hat das Oberlandesgericht Hamm in einem Beschluss deutlich gemacht. Ein Autofahrer kann demnach nicht rügen, dass bei einer Lasermessung nur ein Beamter das Messergebnis abgelesen und ins Protokoll eingetragen hat.
Lasermessungen gelten als anfällig; die Zahl der Fehlerquellen ist enorm. Das fängt bei der Frage an, ob überhaupt das angehaltene Auto anvisiert wurde. Und es hört längst nicht bei der Frage auf, was eigentlich ist, wenn der Messbeamte sich schlicht beim Ablesen vertut oder dem Autofahrer gar was Böses will und einen entsprechenden Aufschlag macht.
Ein Vier-Augen-Prinzip an der Messstelle wäre zwar kein Patentrezept, es könnte aber Bedienungsfehler und vor allem Willkür beherrschbarer machen. Dies gilt umso mehr, als der vermeintliche Temposünder ja noch nicht mal verlangen kann, dass ihm das Display mit der angezeigten Geschwindigkeit gezeigt wird. Bei einer Lasermessung ist der Betroffene in der Regel völlig den Angaben der Beamten ausgeliefert.
Selbst die fehlende vom “technischen Messsystem selbst hergestellte fotografisch-schriftliche Dokumentation des Messergebnisses” (O-Ton Gericht) führt aber nicht dazu, dass die Richter dem Bürger unter die Arme greifen. Sie verweisen lapidar darauf, auch beim Tempomessungen gelte der Grundsatz freier Beweiswürdigung.
Eine Vorgabe an die Polizei, Standards wie etwa in Wirtschaft, Forschung oder Medizin anzuwenden, komme schon deshalb nicht in Betracht, weil es sich um eine “Beweisregel” für die Feststellung einer Tatsache ( = angezeigte Geschwindigkeit) handele. So was sei den Grundsätzen der freien Beweiswürdigung fremd.
Man spürt bei den Ausführungen förmlich den Willen, sich nur ja nicht dem Kern des Problems zu nähern. Dass nämlich schlicht und einfach niemand kontrolliert und es sich auch später praktisch nicht feststellen lässt, ob ein Polizist Mist baut, und zwar entweder fahrlässig oder sogar vorsätzlich.
tl;dr
Autofahrer = Arschkarte
Oberlandesgericht Hamm, Beschluss vom 19. Juli 2012, Aktenzeichen III 3 RBs 66/12 / via Heymanns Strafrecht Online Blog