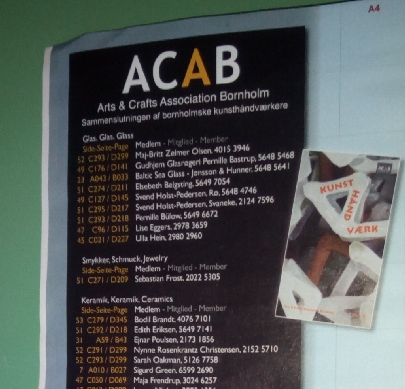Eher unappetitlich verhielt sich in letzter Zeit ein Besucher von bayerischen Kirchen und Friedhofskapellen. Bereits drei Mal entdeckten Kirchenmitarbeiter im Landkreis Lichtenfels (Bayern) Exkremente in Gotteshäusern. Die Hinterlassenschaft fand sich unter anderem im Beichtstuhl. Sie konnte schnell als menschlich eingestuft werden. Die örtliche Polizei ging daraufhin CSI-mäßig an die Arbeit – unter anderem sollte die DNA-Analyse bei der Tätersuche helfen.
„Wir haben eine Zigarettenkippe mit DNA gesichert und prüfen nun, ob die eindeutig zu dem Haufen dazugehört“, wird der Wachleiter von der Presse zitiert. Allerdings müsse man sich gedulden, denn DNA-Analysen in gewichtigeren Fällen, Mord etwa, hätten Vorrang.
Der Fall ist etwas skurril, aber er zeigt, wie die DNA-Analyse mittlerweile im Polizeialltag angekommen ist. Für mich eine gute Gelegenheit, noch einmal auf einen weitgehend unbekannten Fakt hinzuweisen: Die Strafprozessordnung kennt keine Bagatellgrenze für die Verwertung von DNA-Proben.
Die Technik kann also auch in ganz kleinen und kleinsten Fällen zum Einsatz kommen. Was jedenfalls für all jene unangenehm sein kann, deren DNA-Profil in der zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes hinterlegt ist. Waren diese Personen zur falschen Zeit am falschen Ort, können sie auch bei kleinsten Delikten erst mal unter Verdacht auch wegen kleinster Delikte geraten. Denn jedes hinterlegte Profil wird natürlich tagtäglich tausende Male für alle laufenden Fälle durch das Raster gejagt.
Es gibt also gute Gründe, die eigene DNA eher nicht herauszugeben. Mittlerweile ist es gesetzlich erlaubt, dass man als Betroffener freiwillig der Probe zustimmt. Das muss man aber nicht, und zwar auf keinen Fall. Auch eine Begründung für die Weigerung braucht man nicht. Die Probe muss dann ein Richter anordnen. Die juristischen Hürden hierfür sind ganz enorm und keineswegs nur Formsache.
Der bayerische Fall scheint jedenfalls erfolgreich abgeschlossen worden zu sein. Es gibt einen Tatverdächtigen. Eine andere Frage ist natürlich, was am Ende als Straftat übrig bleibt. Der Hausfriedensbruch, über den die Presse spekuliert, dürfte jedenfalls auf wackeligen Beinen stehen. Wenn die Kirche offen war, durfte der Mann sie ja betreten. Aber da gibt es ja noch kirchliches Sonderstrafrecht, nämlich die Störung der Religionsausübung (§ 167 StGB). An allen anderen Orten würde es wohl (nur) bei einer Ordnungswidrigkeit verbleiben, auch bekannt als grober Unfug bzw. Belästigung der Allgemeinheit (§ 118 OWiG).