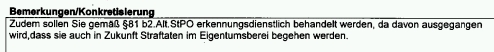Nicht nur die räumliche und möglicherweise persönliche Nähe des Vorsitzenden Richters im Fall Kachelmann zum Vater des mutmaßlichen Opfers sollen zu einem Befangenheitsantrag geführt haben. Die Anwälte Kachelmanns wehren sich wohl auch gegen das Vorhaben des Richters, Kachelmann während der Hauptverhandlung von einem Arzt „beobachten“ zu lassen (Bericht).
Grundsätzlich ist das Gericht berechtigt, einen Angeklagten untersuchen zu lassen. Normalerweise erstreckt sich die Untersuchung aber auf die Frage nach der Schuld- und Verhandlungsfähigkeit. Bei Kachelmann soll der Sachverständige laut den Berichten etwas anderes bewerten – Kachelmanns Glaubhaftigkeit. Damit will sich das Gericht womöglich in der absehbaren Situation „Aussage gegen Aussage“ eine Bewertungsgrundlage verschaffen.
Das ist aus verschiedenen Gründen problematisch.
Kachelmann hat bereits erklärt, an einem Gutachten nicht mitzuwirken. Das ist sein gutes Recht. Er kann sich verweigern, wie jeder andere Angeklagte auch. Das Gericht kann Kachelmann nicht zwingen, mit dem Sachverständigen zu sprechen. Kachelmann muss auch keine Tests oder sonstige Untersuchungen über sich ergehen lassen.
Was also bleibt dem Sachverständigen? Er kann Kachelmann lediglich beobachten, so lange dieser – wie angekündigt – schweigt.
Ist so eine Beobachtung überhaupt sinnvoll?
Ich vermute mal, dass auch der beste Psychiater die Glaubhaftigkeit eines Menschen nicht bewerten kann, wenn er nur dessen Verhalten im Verhandlungssaal und vielleicht mal zufällig in der Gerichtskantine wahrnehmen kann. Bei Kachelmann könnte er sich natürlich auch noch unzählige Fernsehaufnahmen ansehen. Aber das würde den Prozess wahrscheinlich im Chaos versinken lassen, schon was die Gegenwehr von Kachelmanns Anwälten angeht.
Es ist also höchst zweifelhaft, ob dieser Gutachtenauftrag „Überwachung Kachelmann“ überhaupt ein geeignetes Mittel ist. Zumal Kachelmann ja schon Berufs wegen sein Verhalten in der Öffentlichkeit besser steuern kann als „normale“ Menschen. Was also soll da rauskommen, wenn der Sachverständige den Showprofi Kachelmann während der Verhandlung im Auge behält?
Dem absehbaren Nullnutzen solch eines Gutachtens gegenüber steht der Druck, der durch die Anwesenheit des Sachverständigen nun auf Kachelmann und seinen Anwälten lastet. Kachelmann weiß, dass jede seiner Gesten und jeder Blick möglicherweise ein Indiz sein kann, auf dessen Grundlage er mit wissenschaftlichem Anspruch als unglaubhaft bewertet wird. Das ist nicht nur eine unangenehme Situation, sondern beeinträchtigt auch das Lager des Angeklagten.
Selbst wenn man so ein Gutachten grundsätzlich noch für zulässig halten wollte, wo liegen die Grenzen in der konkreten Situation? Darf der Sachverständige zum Beispiel beobachten und bewerten, wie oft Kachelmann mit welchem seiner Anwälte flüstert? Darf er festhalten, von wem die Gesprächsinitiative ausgeht? Darf er eine beschwichtigende Handbewegung des Anwalts und ein sorgenvolles Gesicht Kachelmanns miteinander in Relation setzen – und daraus Schlüsse ziehen?
Gerade die letzten Fragen zeigen, was das für eine unerträgliche Situation für Kachelmann und seine Verteidiger sein muss. Sie sind nicht nur Partei in diesem Strafprozess, sondern auch Objekte eines wissenschaftlichen Gutachters mit „Spezialauftrag“. Wie man da im Rahmen des Möglichen „frei“ agieren können soll, ist mir ein Rätsel. Diese Freiheit ist allerdings Teil des fairen Verfahrens, auf das jeder Angeklagte einen Anspruch hat. Kachelmann und seine Anwälte werden dagegen zur Show genötigt. Das gibt dem Begriff Schauprozess eine ganz neue Bedeutung.
Das Ganze gewinnt einen Spin, wenn man folgendes bedenkt: Der Angeklagte unterliegt keiner Wahrheitspflicht. Er darf lügen. Durch die Positionierung eines Gutachters setzt das Gericht Kachelmann über das normale Maß hinaus unter Druck, von diesem Recht keinen Gebrauch zu machen. Es zwingt Kachelmann quasi dazu, entweder nichts zu sagen – oder die Wahrheit. Letzteres, um nicht beim Sachverständigen „durchzufallen“. Dadurch untergräbt das Gericht den Spielraum deutlich, den ein Angeklagter nach der Strafprozessordnung nun mal hat.
Das geschieht auch dadurch, dass Kachelmann zum Beweismittel gegen sich selbst wird. Und zwar gezwungenermaßen. Egal, wie er sich verhält und was er sagt – sein Verhalten wird im Rahmen des Sachverständigengutachtens später zum Teil der Beweisaufnahme. Es gibt aber den ehernen Grundsatz, dass der Angeklagte nicht an seiner eigenen Überführung mitwirken muss. Aber gerade für den Fall, dass Kachelmann mal was sagen sollte, wäre möglicherweise genau das der Fall. Er würde – unabhängig vom Inhalt seiner Worte – Beweismittel gegen sich selbst schaffen. Diese würden nämlich möglicherweise die – als Beweis verwertbare – Erkenntnis des Sachverständigen stützen, dass Kachelmann nicht glaubhaft ist.
Hieran sieht man auch, worin der Unterschied zu den erwähnten „normalen“ Gutachten liegt. Bei der Frage nach der Verhandlungsfähigkeit geht es darum, ob der Angeklagte ein Gerichtsverfahren durchsteht. Auch das Gutachten über die Schuldfähigkeit ist von der möglichen Tat weitgehend losgelöst. Es erstreckt sich auf die Frage, ob der Angeklagte Unrecht einsehen konnte – sofern er die Tat überhaupt begangen hat. Die Frage nach der Glaubhaftigkeit des Angeklagten erstreckt sich aber auf die Tat. Der Sachverständige prüft gegen den Willen des Angeklagten, ob dieser unglaubhaft ist und somit als Täter in Frage kommt.
Ein möglicher Einwand ist natürlich, dass das Gericht das Beweisergebnis umfassend würdigen muss. Es ist in diesem Rahmen auch seine ureigenste Aufgabe, Aussagen als glaubhaft oder unglaubhaft einzustufen. Somit steht Kachelmann, wie jeder Angeklagte, natürlich auch immer unter Beobachtung des Gerichts. Die Richter sollen gerade aus der Hauptverhandlung einen Eindruck über die Glaubhaftigkeit von Zeugen und des Angeklagten gewinnen. Sie können auf diese Eindrücke aber auch ihre Entscheidung stützen.
Diese Meinungsbildung des Gerichts schöpft aber aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme. Ein Gutachten wäre dagegen Teil der Beweiserhebung. Es wäre klassisches Beweismittel und somit eine tatsächliche Grundlage, auf die das Gericht seine Auffassung – ergänzend – stützen kann (und insoweit auch weniger Verantwortung für das eigene Ergebnis übernehmen muss).
Kachelmann wird im Ergebnis zum Beweismittel gegen sich selbst instrumentalisiert. Ich halte das für unzulässig – und gefährlich.