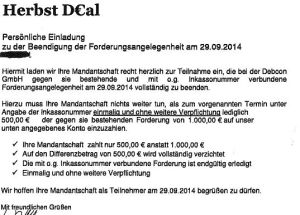In einem Strafprozess muss das Gericht zu Beginn mitteilen, ob es mit den Beteiligten Gespräche über eine Verständigung (sogenannter „Deal“) geführt hat. Das beinhaltet aber auch die Pflicht zur ausdrücklichen Mitteilung, dass eventuell keine solchen Gespräche stattfanden. Dies hat das Bundesverfassungsgericht nun in zwei Fällen entschieden.
Zwei Verurteilte hatten mit ihren Revisionen gerügt, dass im Hauptverhandlungsprotokoll nichts darüber stand, ob es Verständigungsgespräche gab. So ist es gesetzlich eigentlich vorgeschrieben. Der Bundesgerichtshof hatte die Revisionen der Betroffenen dennoch verworfen, weil er eine sogenannte Negativmitteilung über nicht stattgefundene Gespräche für entbehrlich hält.
Leider geschah dies mit einer Begründung, die das Bundesverfassungsgericht nun ganz offen als indiskutabel kritisiert. Die Verfassungsrichter werfen ihren Kollegen am Bundesgerichtshof sogar vor, gegen das Willkürverbot verstoßen zu haben, als sie den eigentlich aus sich heraus verständlichen Wortlaut des Gesetzes gegenteilig deuteten (Beschluss 1, Beschluss 2).
Damit nicht genug, hebt das Bundesverfassungsgericht noch eine weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs zum Theme Verständigung im Strafverfahren auf. Dabei ging es um die Frage, ob der Angeklagte über seine besonderen Rechte belehrt werden muss, bevor er der Verständigung zustimmt. Oder erst, bevor er nach abgeschlossener Verständigung mit seinem Geständnis beginnt.
Diese Belehrung muss laut den Verfassungsrichtern erfolgen, bevor es zur Verständigung kommt. Wird dagegen verstoßen, müssten besondere Umstände vorliegen, um das Urteil nicht unwirksam zu machen (Aktenzeichen 2 BvR 2048/13).