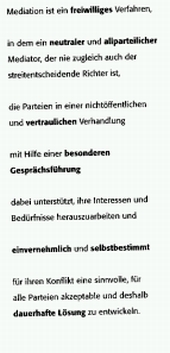Dem Vorsitzenden Richter im Fall Kachelmann sind Fragen gestellt worden. Zu Recht. Er soll den Vater des mutmaßlichen Opfers kennen. Fest steht wohl, dass beide Personen Funktionen in Sportvereinen der Region haben, zwischen denen es dokumentierte Berührungspunkte gab. Es soll der Vater des mutmaßlichen Opfers gewesen sein, der seiner Tochter riet, zur Polizei zu gehen.
Gegenüber der Basler Zeitung wollte sich der Vater übrigens nicht äußern. Als er am Telefon gefragt wurde, ob er den Richter kennt, legte er auf.
Nicht so der Vorsitzende Richter Michael Seidling, der über Kachelmann urteilen soll. Ihm sind ebenfalls Fragen gestellt worden. Hierauf antwortete er. Wenn man der Basler Zeitung glauben darf, sagte Michael Seidling auf Nachfrage:
Ich kenne weder den Vater noch das Opfer. Es gibt keine Nähe zwischen uns.
Lassen wir mal die Frage nach der Bekanntschaft offen. Ob und was da gelaufen ist, wird sicher noch geklärt. Schauen wir uns nur die Äußerung des Richters als solche an. Zunächst ist zu fragen, wieso sich ein Vorsitzender Richter gegenüber der Presse für etwas rechtfertigt, was offenbar noch gar nicht Gegenstand des Verfahrens ist. Kachelmann hat (noch) keinen Befangenheitsantrag gestellt.
Vorauseilende Rechtfertigung gegenüber der Presse ist einem Richter nicht verboten. Ein gutes Bild liefert der Vorsitzende damit aber nicht. Denn er zeigt Dünnhäutigkeit und tut das, woran gerade einem Gericht nicht gelegen sein kann und was zum Beispiel Verteidigern gern, gerade von Richtern, vorgeworfen wird – die Presse zu instrumentalisieren.
Etwas anderes ist aber noch viel mehr zu beanstanden als die Äußerung selbst. Michael Seidling spricht vom „Opfer“. Ob und inwieweit diese Formulierung zutrifft, ist jedoch erst im Verfahren zu klären, das der Jurist leiten soll. Die auch in Mannheim geltende Unschuldsvermutung für den Angeklagten gebietet nicht nur Zurückhaltung gegenüber der Presse, sondern auch Fairness bei eventuellen Äußerungen.
So heißt es in Ziffer 23 der Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren:
Diese Unterrichtung (der Presse) darf weder den Untersuchungszweck gefährden noch dem Ergebnis der Hauptverhandlung vorgreifen; der Anspruch des Beschuldigten auf ein faires Verfahren darf nicht beeinträchtigt werden.
Diese Richtlinien gelten direkt nur für Staatsanwälte. Richter sind, da unabhängig, hieran zwar nicht unmittelbar gebunden. Trotzdem sind die Richtlinien ein Maßstab, an dem auch Richter ihr Verhalten messen lassen müssen.
Das bedeutet also auch für Herrn Seidling: Es steht ihm nicht zu, die Rollen vorher fest zu verteilen. Und Wertungen hat er zu unterlassen, zumal vor Beginn der Hauptverhandlung. Von einem Opfer zu sprechen, setzt aber einen Täter voraus. Natürlich kann man sagen, dass der ständige Präfix „mutmaßlich“ umständlich und ermüdend ist. Das Weglassen kann aber verräterisch sein, wenn hier der zuständige Richter spricht. Zumindest kann es einen verhängnisvollen Eindruck erwecken.
Von einem „Opfer“ zu sprechen, obwohl die mutmaßliche Tat erst aufgeklärt werden muss, ist demnach ein starkes Stück. Vor allem wenn so eine Formulierung aus dem Mund desjenigen kommt, von dem am allerersten verlangt werden muss, sich der Sache unbefangen und vor allem ergebnisoffen anzunehmen. Der Umstand, dass die Äußerung im Rahmen einer momentan unnötigen Selbstrechtfertigung erfolgt, macht alles nicht besser.
Könnte Richter Michael Seidling sich schon durch diese Äußerung als für das Verfahren nicht mehr tragbar erwiesen haben? Es ist hierfür nicht erforderlich, dass der Richter tatsächlich befangen ist. Vielmehr genügt die „Besorgnis“ der Befangenheit, damit ein Richter auf Antrag des Angeklagten abgelöst werden muss. Diese Besorgnis ist gegeben, wenn das Verhalten des Richters einem verständigen Angeklagten den Eindruck vermitteln kann, dass sich der Richter von sachfremden Interessen leiten lässt oder voreingenommen ist.
Wenn man das abwägt, könnte es für Michael Seidling eng werden. Sehr eng.