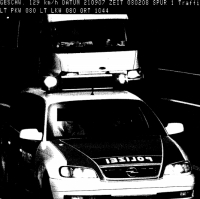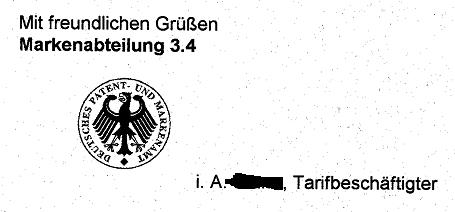Der Bundesgerichtshof hatte darüber zu entscheiden, ob ein Vermieter im Rahmen einer Mieterhöhung einen Zuschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen kann, wenn eine in einem Formularmietvertrag enthaltene Klausel, die den Mieter zu Schönheitsreparaturen verpflichtet, unwirksam ist.
Das hält der Bundesgerichtshof in seiner heute bekannt gegebenen Entscheidung für unzulässig. Zu entscheiden hatte das Gericht folgenden Fall:
Der Beklagte ist Mieter einer (nicht preisgebundenen) Wohnung der Kläger. Der Formularmietvertrag enthält eine Klausel, die den Mieter verpflichtet, die Schönheitsreparaturen „regelmäßig“ innerhalb bestimmter Fristen auszuführen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind Schönheitsreparaturklauseln unwirksam, wenn sie dem Mieter eine Renovierungspflicht nach einem starren Fristenplan ohne Rücksicht auf den Zustand der Wohnung auferlegen.
Die Kläger, die die von ihnen verwendete Klausel nach dieser Rechtsprechung für unwirksam halten, boten dem Beklagten den Abschluss einer Ergänzungsvereinbarung an, mit der die Verpflichtung zur Vornahme der Schönheitsreparaturen durch den Mieter anderweitig geregelt werden sollte.
Da der Beklagte damit nicht einverstanden war, verlangten die Kläger die Zustimmung zur Erhöhung der Miete um einen Zuschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete für die von ihnen als Vermietern zu erbringenden Schönheitsreparaturen in Höhe von monatlich 0,71 € je qm. Das entspricht dem Betrag, der im öffentlich geförderten Wohnungsbau bei der Kostenmiete angesetzt werden darf, wenn der Vermieter die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt (§ 28 Abs. 4 Satz 2 der Zweiten Berechnungsverordnung). Der Beklagte verweigerte die Zustimmung zu einer Erhöhung der Miete um diesen Zuschlag.
Der daraufhin erhobenen Klage auf Zustimmung zur Mieterhöhung um monatlich 0,71 € je qm hat das Amtsgericht stattgegeben. Auf die Berufung des Beklagten hat das Landgericht die Klage abgewiesen, soweit die Kläger die Zustimmung zur Erhöhung der Miete um monatlich mehr als 0,20 € je qm verlangt haben.
Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision beider Parteien entschieden, dass der Vermieter nicht berechtigt ist, einen Zuschlag zur ortsüblichen Miete zu verlangen, wenn der Mietvertrag eine unwirksame Klausel zur Übertragung der Schönheitsreparaturen enthält. Nach § 558 Abs. 1 Satz 1 BGB kann der Vermieter lediglich die Zustimmung zur Erhöhung der Miete bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen; einen darüber hinausgehenden Zuschlag sieht das Gesetz nicht vor.
Er ließe sich auch nicht mit dem vom Gesetzgeber vorgesehenen System der Vergleichsmiete in Einklang bringen. Insoweit bilden die jeweiligen Marktverhältnisse den Maßstab für die Berechtigung einer Mieterhöhung. Der begehrte Zuschlag orientiert sich aber an den Kosten für die Vornahme der Schönheitsreparaturen. Mit der Anerkennung eines Zuschlags würde daher im nicht preisgebundenen Mietwohnraum ein Kostenelement zur Begründung einer Mieterhöhung ohne Rücksicht darauf herangezogen, ob diese Kosten am Markt durchsetzbar wären.
Die Kläger können die beanspruchte Mieterhöhung auch nicht im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung nach §§ 133, 157 BGB verlangen, weil eine durch die Unwirksamkeit einer Vertragsklausel entstandene Lücke nur dann der Vervollständigung bedarf, wenn dispositives Gesetzesrecht hierfür nicht zur Verfügung steht und die ersatzlose Streichung der unwirksamen Klausel keine angemessene, den typischen Interessen der Vertragsparteien Rechnung tragende Lösung bietet. Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt. Nach der gesetzlichen Regelung hat der Vermieter die Last der Schönheitsreparaturen zu tragen (§ 535 Abs. 1 Satz 2 BGB). Wenn dasselbe Ergebnis als Folge einer unwirksamen vertraglichen Abwälzung der Renovierungslast auf den Mieter eintritt, stellt dies keine den typischen Interessen der Vertragspartner widersprechende Regelung dar.
Ebenso wenig kann die Forderung nach einem Zuschlag zur ortsüblichen Vergleichsmiete auf einen Wegfall der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB) gestützt werden. Für eine Berücksichtigung von Störungen der Geschäftsgrundlage besteht kein Raum, wenn nach der gesetzlichen Regelung derjenige das Risiko zu tragen hat, der sich auf die Störung der Geschäftsgrundlage beruft. Das Risiko der Unwirksamkeit von Formularklauseln hat gemäß § 306 Abs. 2 BGB derjenige zu tragen, der derartige Klauseln verwendet. Denn nach dieser Bestimmung richtet sich der Vertrag im Falle der Klauselunwirksamkeit nach den sonst zur Anwendung kommenden gesetzlichen Regelungen. Das bedeutet hier, dass mangels wirksamer Abwälzung der Schönheitsreparaturen die Kläger als Klauselverwender nach § 535 Abs. 1 Satz 2 BGB die Instandhaltungslast in vollem Umfang zu tragen haben.
Urteil vom 9. Juli 2008 – VIII ZR 181/07