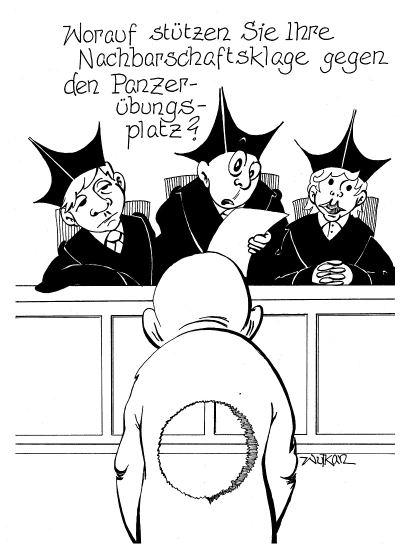Einer der mutmaßlichen Polizistenmörder von Augsburg wird womöglich um einen Prozess herumkommen. Das Augsburger Landgericht stellte nun das Verfahren gegen ihn ein. Raimund M. ist derzeit verhandlungsunfähig.
Ungewöhnlich ist es nicht, dass Angeklagte krank werden. Auch so schwer, dass gegen sie nicht weiter verhandelt werden kann. Im Fall des 60-jährigen M., der mit seinem Bruder gemeinsam einen Polizisten getötet haben soll, kommen aber besondere Umstände ans Licht. Der Zustand des Angeklagten dürfte nämlich wesentlich mit den Haftbedingungen zusammenhängen, die M. seit seiner Festnahme im Herbst letzten Jahres erdulden musste.
Offenbar ist die Augsburger Justiz bei der Verwahrung des Angeklagten bis an die Grenzen gegangen – oder sogar darüber hinaus. Fest steht, dass M. in strenger Isolation gehalten wurde. Täglich 23 Stunden allein in der Zelle, 1 Stunde allein beim Hofgang. Das Gefängnispersonal hatte ein Sprechverbot gegenüber dem Angeklagten. Hinzu kamen Dauerfesselungen außerhalb des Haftraums, selbst im Anstaltsbereich. Und nicht zuletzt entwürdigende Nacktkontrollen, teilweise mehrmals täglich, auußerdem nicht auf die gesundheitlichen Probleme des Angeklagten angepasste Ernährung. Wie die Isolationshaft aussah und welche Folgen sie hatte, beschrieb Julia Jüttner jüngst eindrücklich auf Spiegel online.
M. ist an Parkinson erkrankt. Dass die Krankheit, verbunden mit heftigsten Depressionen, aber jetzt so durchschlägt, liegt nach Auffassung von M.s Anwalt an eben jenen Haftverhältnissen. Was zunächst als Vorwurf gegen die Justiz im Raum stand, hat aber auch der gerichtlich bestellte Gutachter mittlerweile mehrfach bestätigt. Bei vernünftigeren Haftbedingungen und besserer medizinischer Versorgung würde es dem Verdächtigen heute vermutlich besser gehen. Wahrscheinlich so gut, dass gegen ihn verhandelt werden könnte.
Das Landgericht Augsburg hat das Verfahren jetzt ausgesetzt. Der Prozess gegen M. muss also später komplett neu aufgerollt werden. Ob es jemals so weit kommt, ist allerdings fraglich. Der Sachverständige geht wohl davon aus, es spreche viel für eine dauernde Verhandlungsfähigkeit. Stünde dies fest, müsste M. auch aus dem Gefängnis entlassen werden. Er wäre dann ein freier Mann, zumindest so lange er weiter als verhandlungsunfähig gilt.
Für die Angehörigen des erschossenen Polizisten ist das natürlich schwer zu ertragen. Hierfür müssen sie die Schuld aber nicht beim Angeklagten suchen. Sondern bei denen, die sich solch mehr als grenzwertige Haftbedingungen ausgedacht haben.