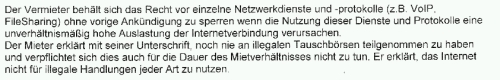Der saarländische Ministerpräsident Peter Müller möchte Bundesverfassungsrichter werden. Offenbar stehen seine Chancen gut, im ziemlich undurchsichtigen, längst dem parteipolitischen Proporzdenken anheimgefallenen Auswahlverfahren zum Zuge zu kommen. Immerhin hat Müller schon seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Er dementiert auch nicht, die Stelle ins Auge gefasst zu haben.
Der Job am Bundesverfassungsgericht ist sicher so was wie ein juristischer Olymp. Schon von der Natur der Sache her sollten, ja müssen dort erstklassige Juristen sitzen. Gehört Peter Müller dazu? Die Zeit hat nach die Spuren von Müllers juristischer Karriere gesucht und ist auf nichts gestoßen, was man spektakulär nennen könnte.
Fest steht, Müller war vier Jahre Richter. Erst am Amtsgericht Ottweiler, dann in einer Zivilkammer des Landgerichts Saarbrücken. Vorher war Müller wissenschaftlicher Assistent an der Universität des Saarlandes.
Die Zeit-Recherche nach akademischen Schriften des späteren Ministerpräsidenten brachte nichts zu Tage. Eine Doktorarbeit gibt es von Müller nicht; er hat während seiner Zeit an der Uni nicht promoviert. Auch das eigene Büro des Politikers soll letztlich nur einen 20-seitigen Aufsatz in einer Festschrift aus dem Jahre 1984 präsentiert haben, den Müller geschrieben haben will. Ob das der Fall ist, wird sich nur schwer überprüfen lassen – als Autor ist im Werk selbst laut Zeit nur der Professor genannt, bei dem Müller tätig war.
Und sonst so? Dazu die Zeit:
Durch Zeugen belegt ist schließlich, dass Müller … im Jahr 2006 ein Grußwort zum 25-jährigen Bestehen des Saarbrücker Rechtsforums gehalten hat, in freier Rede, wie sich einer der Anwesenden zu erinnern glaubt, weshalb in der Schriftform nichts Näheres zu diesem Ereignis überliefert ist.
Laut Wikipedia errang Müller im Jahr 1990 ein Landtagsmandat und ist seitdem vom Justizdienst beurlaubt. Für die letzten 20 Jahre finden sich in der Wikipedia auch keine Hinweise auf eine Tätigkeit mit juristischem Bezug. Stattdessen war Müller offenbar in den letzten 20 Jahren Berufspolitiker und CDU-Parteisoldat.
Aber vielleicht ist es ja gerade das, was ihn in den Augen der Entscheidungsträger für das Richteramt qualifiziert.