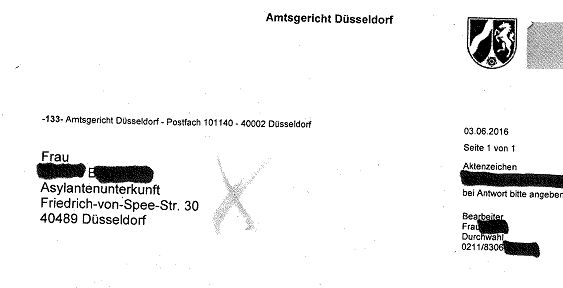Die Polizei beklagt ja gerne Überlastung. Ein ganz klein wenig kann es aber womöglich auch daran liegen, dass die Prioriäten nicht immer richtig gesetzt werden. Als Beispiel dieses Ereignis aus dem Sächsischen Polizeibericht:
Plötzlich stand ein Mitschüler (12) neben dem Mädchen (11) und verdrehte ihr den Arm. Er zog ihren Rucksack vom Rücken und stopfte ihn in einen Mülleimer. Dazu grinste er provozierend und rief immer wieder schadenfroh den Namen der Fünftklässlerin. Dann eskalierte die Situation.
Der 12-Jährige, der Freude dabei empfand, das Mädchen zu ärgern, steigerte sich in das Geschehen hinein. Er entleerte den Inhalt des Rucksacks in den Müll, nahm ihr Portmonee weg, warf das Telefon zu Boden. Auf die Bitten der 11-Jährigen, die Sachen zurückzugeben, ging er nicht ein. Im Gegenteil. Letztlich zerrte er sie zu Boden, trat und schlug so heftig nach ihr, bis die Nase zu bluten begann und sie Prellungen erlitt.
In besonders erniedrigender Weise spuckte er das Mädchen an. Dann erst „trollte“ er sich und verschwand mit ihrer Essenkarte und einigen Cent-Münzen. Die Polizei prüft den Sachverhalt wegen Körperverletzung, Diebstahl und Beleidigung.
Statt groß zu „prüfen“ und den Aktenumfang schwellen zu lassen, sollten die zuständigen Polizeibeamten lieber den Staatsanwalt anrufen. Oder ihm gleich die Unterlagen faxen. Denn dem Staatsanwalt, dem „Herrn des Verfahrens“, dem die Polizei zuarbeitet, bleibt bei so einem Sachverhalt nur eine Entscheidung. Er muss das Verfahren „mangels Tatverdachts“ einstellen. Und zwar sofort, ohne wenn und aber.
Das liegt ganz einfach daran, dass 12-Jährige nicht strafmündig sind (§ 19 StGB). Es liegt also ein sogenanntes Verfahrenshindernis vor, welches zwingend zu einer Einstellung des Verfahrens mangels Tatverdachts führt (§ 170 StPO). Dieses Verfahrenshindernis muss in jedem Stadium berücksichtigt werden.
Da eine Bestrafung des Jungen ausscheidet, bleiben nur Maßnahmen des Jugendamtes oder des Familiengerichts. Aber damit hat die Polizei dann nichts mehr zu tun. Sie könnte sich somit anderen Dingen widmen.