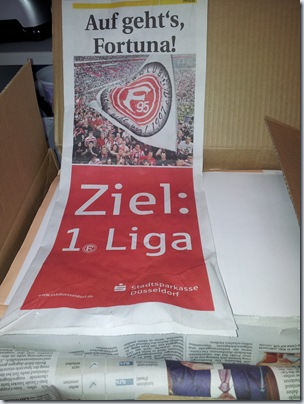So läuft das mit den Massengentests: Wer nicht erscheint und freiwillig seine Speichelprobe abgibt, ist verdächtig – obwohl er bislang nichts Illegales getan hat. Derzeit kann man das im Mordfall Nelli Graf beobachten. Über 200 Männer, Nachbarn des Opfers im westfälischen Halle, sind nach einem Zeitungsbericht dem Gentest ferngeblieben. Nun sollen sie Besuch von der Polizei erhalten. Diese will ihre Alibis überprüfen.
Was die Polizei “Ausschlussverfahen” nennt, ist in Wirklichkeit die Abschaffung der rechtsstaatlichen Regel, nach der man nicht seine Unschuld beweisen muss. Um an diesem Grundsatz wenigstens formal festhalten zu können, sind die Tests offiziell noch “freiwillig”. Aber eben nur auf dem Papier, wie das Verhalten der Polizei in Halle nun gerade wieder zeigt.
Die Männer, die jetzt Besuch von der Polizei bekommen und Auskunft zu ihren Alibis geben sollen, haben sich nämlich nichts zuschulden kommen lassen. Außer dass sie von ihrem Recht Gebrauch gemacht haben, die staatlich postulierte “Freiwilligkeit” für sich in Anspruch zu nehmen.
Wenn die Polizei via Presse erklärt, die Verweigerer müssten als “Zeugen” Auskunft geben, geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter – und verkennt die Rechtslage. Ob nun fahrlässig oder vorsätzlich, lasse ich mal offen. Jedenfalls scheint der Polizei in Halle den Bürgern lieber nicht sagen zu wollen, dass niemand, Zeugen eingeschlossen, mit der Polizei reden muss. Dazu bedürfte es zumindest einer Vorladung durch den Staatsanwalt. Einem Kommissar, der mal so an der Haustür klingelt, muss man schlicht und einfach nicht Rede und Antwort stehen.
Überdies ist natürlich höchst zweifelhaft, ob die 200 tatsächlich noch Zeugen sind. Es spricht viel dafür, sie als Beschuldigte zu betrachten. Immerhin kommt die Polizei ja nicht ohne Grund vorbei. Aber selbst wenn sie noch Zeugenstatus hätten, dürfte jeder auch beim Staatsanwalt, sofern dieser eine Ladung schickt, die Auskunft zu seinem Alibi verweigern. Das sind nämlich Angaben, durch die man sich selbst (noch stärker) in Verdacht bringen könnte, eine Straftat begangen zu haben.
Dafür gibt es, aus gutem Grund, ein Auskunftsverweigerungsrecht auch für Zeugen. Das ist der Grundsatz, dass man sich nicht selbst belasten muss. Wieder so eine rechtsstaatliche Sache, die den Ermittlern offenbar nicht recht in den Kram passt. Letztlich können da nur mutige Richter helfen, die legales Verhalten nicht als Grundlage für einen Tatverdacht akzeptieren – und der Polizei die dann absehbaren Durchsuchungsbeschlüsse verweigern. Ich wäre allerdings positiv überrascht, wenn mal ein Richter an der Basis den Mut hat, auf Einhaltung von Recht und Gesetz zu pochen. Höchste Zeit wäre es in jedem Fall.