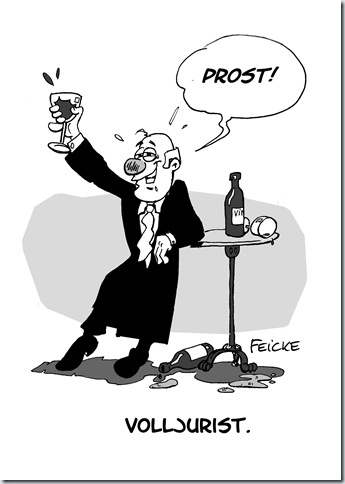Es ist schon interessant, was die Polizei so alles an Daten in ihren Computern hortet. Am Beispiel eines Mannes, der in Berlin ein Kind in einer Schule missbraucht haben soll, wird dies mal wieder deutlich.
Spiegel online berichtet von den Vorbelastungen des Mannes:
Laut Staatsanwaltschaft ist der 30-Jährige bereits wegen Betrugs und Körperverletzung vorbestraft. Auch war er laut Polizei bereits früher mit einer exhibitionistischen Handlung aufgefallen. Das Verfahren gegen den damals noch nicht Volljährigen sei aber eingestellt worden.
Man beachte die Quellen. Die Staatsanwaltschaft weiß etwas von Vorstrafen. Vermutlich hat sie das Bundeszentralregister, die Kartei für verurteilte Straftäter, abgefragt. Die Polizei weiß aber darüber hinaus, dass vor mindestens zwölf, möglicherweise aber auch mehr Jahren gegen den Mann wegen Exhibitionismus ermittelt wurde. Nur ermittelt wie gesagt, zu einer Verurteilung kam es nicht.
Weil gegen den Mann kein Urteil erging, durfte der mögliche Exhibitionismus logischerweise in kein öffentliches Register eingetragen werden. Also insbesondere auch nicht in das Erziehungsregister, in dem Urteile des Jugendgerichts festgehalten werden.
Alle Einträge im Erziehungsregister müssen überdies mit Vollendung des 24. Lebensjahres gelöscht werden, wenn gegen den Beschuldigten nur milde Sanktionen ausgesprochen wurden. Ein Beispiel sind die bekannten Arbeitsstunden. Spätestens mit dem 24. Lebensjahr hätte die Exhibitionismus-Sache also aus dem Erziehungsregister raus sein müssen – selbst wenn der Verdächtige überhaupt verurteilt worden wäre. Die Eintragung dürfte dem Mann auch dann nicht mehr entgegengehalten werden, wenn sie aus Versehen doch noch im Register stünde.
Aber die Berliner Polizei weiß halt mehr als die an sich zuständigen Stellen. Sie hat die Daten über ein eingestelltes Verfahren offenbar noch im Computer, obwohl mindestens zwölf Jahre vergangen sind und das Verfahren sich gegen einen Jugendlichen richtete. Wenig überraschend: Nach den Vorschriften der Strafprozessordnung dürften diese Daten eigentlich gar nicht mehr vorhanden sein.
Aber selbst wenn sie rechtzeitig und pflichtgemäß “gelöscht” worden sein sollten, heißt das bei unserer Gesetzeslage noch nicht, dass die Daten auch wirklich nicht mehr vorhanden sind. Gut möglich ist nämlich, dass die Informationen aus der sogenannten Vorgangsverwaltung stammen. Diese besondere Datei hält, und das ist wirklich bizarr, auch Daten zu Verfahren fest, die es eigentlich gar nicht mehr geben darf.
Das geschieht offiziell zu Archivzwecken. Mitunter aber auch schlicht, um bei passenden Anlass Löschfristen umgehen zu können. Der Berliner Fall könnte hierfür ein Beispiel sein.