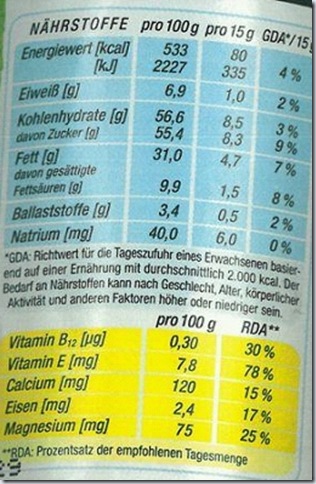Für die Nebenkostenabrechnung hat der Vermieter zwölf Monate Zeit. Bis dahin muss er sie aber nicht nur fertigstellen, sondern dem Mieter auch zukommen lassen. Deshalb kommen Vermieter mitunter zum Ende des Jahres ins Schwitzen, weil die Abrechnungen spätestens am 31. Dezember bei ihren Mietern im Briefkasten liegen müssen.
Ein Vermieter war nicht nur sehr spät mit der Abrechnung fertig. Ausgerechnet am Silvestertag war auch noch das Wetter schlecht, so dass er sich nicht auf den Weg zu seinen Mietern machen wollte. Er rief deshalb die Mieter an und fragte, ob er die Abrechnung in der ersten Januarwoche bringen kann. Die Mieter waren einverstanden.
Später berief sich der Mieter aber aufs Gesetz. Das erklärt die Zwölfmonatsfrist nämlich zur absoluten Obergrenze. Außerdem sind Abweichungen zu Ungunsten des Mieters grundsätzlich unwirksam. Hierauf berief sich der Mieter und wollte seine Zusage nicht mehr gelten lassen.
Das Landgericht Koblenz gab allerdings dem Vermieter recht. Nach Auffassung der Richter verstößt es gegen Treu und Glauben, wenn der Mieter dem Vermieter aus freien Stücken entgegenkommt und später nichts mehr davon wissen will. Überdies sei schlechtes Wetter ein nachvollziehbarer Grund gewesen. Wenn diese beiden Faktoren zusammenkämen, greife die gesetzliche Höchstfrist nicht ein.
Landgericht Koblenz, Urteil vom 28.Januar 2010, Aktenzeichen 14 S 318/08