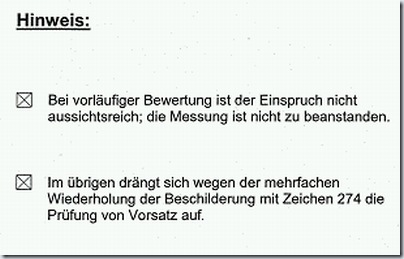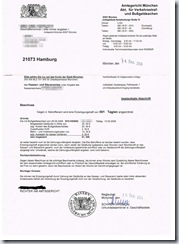Sky nervt. Weniger das Programm, eher das “Forderungsmanagement”. Schon zum wiederholten Mal verlangt Sky von mir eine Smartcard zurück, und zwar jene mit der Seriennummer 12405538227. Jetzt sattelt Sky sogar noch drauf und schreibt mir:
Sollten wir die Geräte nicht binnen 14 Tagen zurückerhalten, sehen wir uns leider dazu gezwungen, Schadensersatz in Höhe von 35,00 Euro geltend zu machen.
Dieses Schreiben ist schon deshalb unverschämt, weil ich nach dem letzten Brief bei Sky angerufen habe. Ich zahlte 14 Cent pro Minute dafür, einem Callcenter-Agent zu erklären, dass ich an Sky keine Smartcard zurücksenden kann, weil ich nie eine Smartcard von Sky erhalten habe.
Ich bin nämlich schon etliche Jahre Kunde beim Kabelanbieter Unitymedia. Das Sky-Abo habe ich später zugebucht. Was bei Unitymedia so läuft, dass die im Betrieb befindliche Smartcard von Unitymedia einfach zusätzlich für Sky freigeschaltet wird. Degemäß habe ich nie Hardware von Sky bekommen, also weder Receiver noch Smartcard.
Ich hatte bei dem Telefonat das Gefühl, der Mitarbeiter, versteht, was ich meine. Zumindest als ich ihn darauf hinwies, dass die Smartcard mit der Seriennummer 12405538227 vor mir liegt, eindeutig von Unitymedia stammt und demgemäß allenfalls an Unitymedia zurückgeschickt werden muss.
Ich weiß nicht, was Sky mit den Telefongebühren macht, die ich für diese Aufklärung verbraten habe. Mit den dabei geflossenen Informationen scheint das Unternehmen jedenfalls herzlich wenig anzufangen. Anders kann ich mir die neuerliche Mahnung mit Androhung von Schadensersatz nicht erklären.
Überdies stellt sich doch die Frage, wieso Sky überhaupt eine Smartcard zurückhaben will, die eindeutig von einer anderen Firma ausgegeben wurde. Mit der ellenlangen Seriennummer sollte es doch wohl möglich sein zu prüfen, ob die Karte überhaupt zum eigenen Bestand gehört. Ganz abgesehen davon natürlich, dass schon in den Vertragsunterlagen steht, dass ich als Kunde auf Hardware verzichte.
Ich habe Sky heute die Geschichte aufgeschrieben. Nun hoffe ich auf Einsicht und darauf, künftig mit solchem Kinderkram verschont zu werden. Vielleicht trägt ja auch die beigefügte Anwaltsrechnung zur Entscheidungsfindung bei. 46,41 Euro sind sicher nicht die Welt, aber die möchte ich jetzt doch gerne haben.