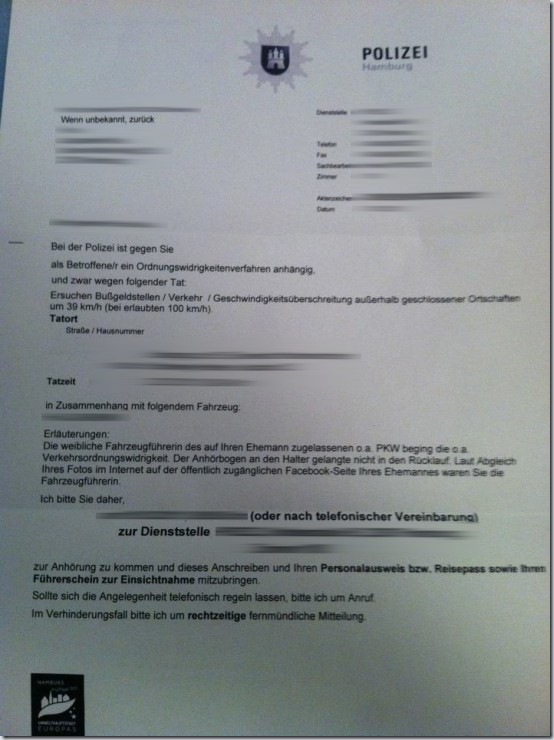Der Reemtsma-Entführer Thomas Drach hat sich heute zum Auftakt eines neuen Prozesses gegen ihn geweigert, beim Transport vom Gefängnis ins Gericht eine Augenbinde zu tragen. Das Gericht hatte die Binde zwar nicht angeordnet, aber die mit dem Transport beauftragte Sondereinheit der Hamburger Polizei hielt sie für erforderlich. Nachdem Drach sich weigerte, die Binde aufzusetzen, ordnete das Gericht seine Zwangsvorführung für den Nachmittag an – einschließlich des “Sehschutzes”.
Solche Maßnahmen kennt man in der Öffentlichkeit ansonsten nur vom Bundeskriminalamt. Dessen Mitarbeiter lassen es sich insbesondere bei der Festnahme von Terrorverdächtigen nicht nehmen, die Beschuldigten bei der Landung des Hubschraubers am Bundesgerichtshof in Karlsruhe in roter Gefangenenkluft und überdies blind zum Ermittlungsrichter zu führen. Zufälligerweise geschieht dies immer so, dass die am Geländerand postierten Paparazzi stets einen Schnappschuss kernig dahinschreitender Beamter und guantanamomäßig gefesselter Verdächtiger machen können.
Nun also ein ähnliches Prozedere beim Reemtsma-Entführer. Auch wenn dieser als gefährlich und fluchtgeneigt eingestuft wird, begibt sich das Gericht mit der Augenbinde auf rechtlich unsicheres Terrain.
Drach ist derzeit Strafgefangener, so dass für ihn in erster Linie die Vorschriften des Strafvollzugs und nicht die für Untersuchungsgefangene gelten. Danach ist es Sache des Anstaltsleiters, die Sicherungsmaßnahmen für einen Transport zu klären. Das Hamburger Strafvollzugsgesetz, aber auch das des Bundes kennen als “besondere Sicherungmaßnahme” in diesem Zusammenhang nur die Fesselung des Gefangenen. Andere Maßnahmen sind auch nicht entsprechend erlaubt. Eine entsprechende Anordnung des Anstaltsleiters wäre also rechtswidrig.
Was das Gericht anordnen darf, ist dagegen nicht so genau geregelt. Nach dem Gerichtsverfassungsgesetz steht dem Vorsitzenden die “Sitzungspolizei” zu. Die sitzungspolizeiliche Gewalt beginnt und endet aber spätestens am Gerichtsgebäude, das heißt die Ausführung des Transports kann das Gericht nicht über seine Befugnisse im Rahmen der Sitzungspolizei steuern.
Bleiben nur die Regelungen über die Untersuchungshaft. Wenn man sie denn anwenden will, obwohl Drach ja in Strafhaft sitzt, kann das Gericht zur Abwendung einer Fluchtgefahr “Beschränkungen” anordnen. Dazu kann auch die Fesselung des Angeklagten gehören. Auch eine “Blendung” des Angeklagten ist sicher eine denkbare Maßnahme – auch wenn sie in der Fachliteratur, die ich zu Rate gezogen habe, noch nicht einmal erwähnt wird.
Ich persönlich meine, dass ein Gericht die Maßnahme nicht anordnen kann. Wenn die Regeln für den Strafvollzug einen eindeutigen Katalog enthalten, der Augenbinden gerade nicht vorsieht, wird man diese bei der Untersuchungshaft kaum in den ohnehin sehr schwammigen Begriff “Beschränkung” einsortieren können. Fluchtgefahr bleibt ja Fluchtgefahr, unabhängig ob sie im Strafvollzug oder in der Untersuchungshaft auftritt. Warum sollte einem Anstaltsleiter für seinen Strafgefangenen bei einem Transport weniger erlaubt sein als einem Gerichtsvorsitzenden?
Letztlich bleiben ohnehin zwei Fragen. Die nach der Verhältnismäßigkeit. Und ob Augenbinden noch mit dem Anrecht eines jeden Menschen vereinbar sind, vom Staat nicht zu einem bloßen Objekt herabgewürdigt zu werden. Drachs Anwalt bezeichnete den Transport seines Mandanten heute als “Angriff auf die Menschenwürde”. Dem würde ich zustimmen. Außerdem tut martialisches Auftreten der Staatsmacht, noch dazu im Jack-Bauer-Stil, einem demokratischen Gemeinwesen niemals gut.