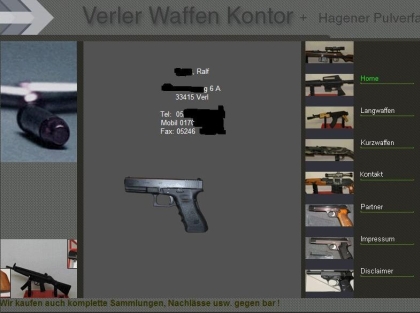Der Privatverkäufer auf ebay war zweifellos fleißig. In anderthalb Monaten verkaufte er 182 Mobiltelefone, davon 46 Stück Neuware in Originalverpackung. 22 Mobiltelefone hatte der Mann im fraglichen Zeitraum bei ebay selbst gekauft. Somit war die Herkunft von 160 Geräten ungeklärt – jedenfalls in den Augen der bayerischen Polizei. Die schaut sich regelmäßig auf ebay um und sucht Hinweise auf Straftaten. In diesem Fall störte sie sich daran, dass der Verkäufer kein Gewerbe angemeldet hatte. Überdies verkaufte er gerade die Neuware zu sehr günstigen Preisen.
Was lag näher, als mal bei ihm vorbeizuschauen? Die Polizei sah selbst noch keinen konkreten Verdacht auf eine Straftat. Sie wollte ihre Durchsuchung deshalb auf das Polizeiaufgabengesetz stützen. Nicht nötig, befand ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Nürnberg und haute einen klassischen Durchsuchungsbefehl raus. Tatverdacht: Hehlerei.
Auch das Beschwerdegericht bejahte den Tatverdacht. Angesichts der hohen Anzahl der versteigerten Geräte insgesamt und des hohen Anteils von neuwertigen, originalverpackten Geräten bestehe durchaus der Verdacht, dass die Geräte nicht auf legalem Weg in den Besitz des Verkäufers gelangt seien. Die Maßnahme sei auch verhältnismäßig, weil mit der Auffindung von Beweismitteln zu rechnen gewesen sei. Es erscheine zudem von vornherein aussichtslos, die Ersteher der Geräte, die zu dem Beschwerdeführer aufgrund der Anonymität der Plattform regelmäßig keinen weiteren Kontakt hätten und sich allein auf dessen Angaben zu der Ware verlassen müssen, zu deren Herkunft zu befragen.
Das Bundesverfassungsgericht hat den Durchsuchungsbeschluss nun für rechtswidrig erklärt.
Die Entscheidung zeigt zunächst, welch hohen Stellenwert das Gericht der Unverletzlichkeit der Wohnung einräumt:
Art. 13 Abs. 1 GG gewährt einen räumlich geschützten Bereich der Privatsphäre, in dem jedermann das Recht hat, in Ruhe gelassen zu werden. Erforderlich zur Rechtfertigung eines Eingriffs in die Unverletzlichkeit der Wohnung ist jedenfalls der Verdacht, dass eine Straftat begangen worden sei. Das Gewicht des Eingriffs verlangt Verdachtsgründe, die über vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen hinausreichen. Ein Verstoß gegen diese Anforderungen liegt vor, wenn sich sachlich zureichende plausible Gründe für eine Durchsuchung nicht mehr finden lassen. Eine Durchsuchung darf nicht der Ermittlung von Tatsachen dienen, die zur Begründung eines Verdachts erforderlich sind; denn sie setzt einen Verdacht bereits voraus.
Die notwendigen Verdachtsmomente vermag das Gericht nicht zu erkennen:
Der Verdacht der Hehlerei (§ 259 StGB) setzt unter anderem den Verdacht voraus, dass die Sache durch einen Diebstahl oder ein anderes Vermögensdelikt erlangt worden ist. Im vorliegenden Fall wird der Tatverdacht allein darauf gestützt, dass der Beschwerdeführer in kurzer Zeit eine große Anzahl von Mobiltelefonen, von denen einige originalverpackt gewesen sind, über die Internetplattform ebay versteigert und dabei Verkaufserlöse erzielt hat, die in der Regel unter dem Preis der billigsten Anbieter gelegen haben.
Hierbei handelt es sich indes noch nicht um zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür, dass die Mobiltelefone aus einer gegen fremdes Vermögen gerichtete Tat stammten. Allein aus der Anzahl der verkauften Mobiltelefone kann ohne weitere Anhaltspunkte nicht auf eine Straftat geschlossen werden.
Solche weiteren tatsächlichen Anhaltspunkte werden in den angegriffenen Beschlüssen indes nicht aufgezeigt. Der Hinweis auf die Verkaufserlöse ist eine bloße Behauptung; es hätte zumindest der beispielhaften Gegenüberstellung von erzielten und handelsüblichen Preisen bedurft.
Auch aus dem Auftreten des Beschwerdeführers als Privatperson kann nicht ohne weiteres auf die Verwirklichung des Straftatbestandes der Hehlerei geschlossen werden. Die Annahme des Verdachts der Hehlerei beruhte daher auf bloßen Vermutungen, die den schwerwiegenden Eingriff in die grundrechtlich geschützte persönliche Lebenssphäre nicht zu rechtfertigen vermögen.
Die Geschichte zeigt, wie der „fürsorgliche Staat“ mittlerweile funktioniert. Nichts an den Verkäufen war illegal. Aber in der Summe sahen die Ermittler Ansätze, um misstrauisch zu sein. Um dieses Misstrauen zu bestätigen, wird dann aber der Fehler begangen: Legales Verhalten, Legales Verhalten und legales Verhalten werden addiert – und in der Summe kommt der Verdacht auf illegales Verhalten raus.
Glücklicherweise streicht das Bundesverfassungsgericht mitunter noch solche Milchmädchenrechnungen mit dem Rotstift durch.
Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die wenigsten Betroffenen bis nach Karlsruhe gehen. Überdies nimmt das Bundesverfassungsgericht die weitaus meisten Verfassungsbeschwerden auch aus diesem Bereich nicht zur Entscheidung an. Die Richter in Karlsruhe setzen immer noch darauf, dass die von ihnen exemplarisch entschiedenen Fälle nicht nur von den Richtern an der Basis gelesen, sondern auch als Leitfaden verstanden werden.
Meine alltägliche Erfahrung belegt, genau dies ist nicht der Fall. Die „Vorgaben“ aus Karlsruhe werden gerne ignoriert, denn im Zweifel kostet Nachschauen ja nichts. Oder, um ein in letzter Zeit modern gewordenes, aber dennoch zynisches Argument aus Durchsuchungsbeschlüssen zu zitieren:
Die Durchsuchung dient letztlich auch dazu, Beweismittel aufzufinden, welche den Beschuldigten entlasten können.
Robustes Vorgehen fällt auch leicht, denn es drohen ja keinerlei dienstliche Konsequenzen. Und in den allermeisten Fällen kommt man nicht mal zu einem Beweisverwertungsverbot – dem angeblich höherrangigen Strafverfolgungsinteresse des Staates sei Dank.
Wieso sollte man in dieser Konstellation den Grundrechten des Bürgers im Zweifel Vorrang einräumen?
Link zur Entscheidung