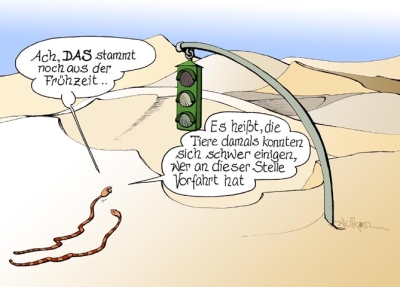Angeblich steigt die Gewalt gegen Polizisten. Kein Wunder, dass erst Lobbyisten und nun auch die Innenminister härtere Strafen fordern. Seltsamerweise wird hierbei größter Wert darauf gelegt, das Sonderrecht in Form des § 113 Strafgesetzbuch zu verschärfen. Der exklusive Paragraf heißt „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“. Er greift schon dann ein, wenn jemand sich gegen Polizisten wehrt. Ob ein Beamter dabei verletzt wird, spielt keine Rolle.
Nun steht es außer Frage, dass unangenehme Situationen zum Berufsbild eines Polizisten gehören. Der Job hat halt nun mal ein anderes Anforderungsprofil als Industriekaufmann. Wenn Polizeibeamten für ihr Gehalt schon geringfügig mehr Dickfelligkeit abverlangt wird, darf man davon ausgehen, dass Widerstandshandlungen ohne Verletzung des Beamten mit dem bisherigen Strafrahmen gut abgedeckt sind. Schon für den Widerstand als solchen drohen immerhin bis zu zwei Jahre Gefängnis. Dafür muss, das sei betont, der Beschuldigte keinem Polizisten auch nur ein Haar gekrümmt haben.
Unter den Tisch gekehrt, wenn nicht sogar bewusst verschwiegen wird eine Tatsache: Widerstandshandlungen, bei denen Polizisten verletzt werden, sind keineswegs nur mit Gefängnis bis zu zwei Jahren bedroht.
Vielmehr greifen zum Schutz der Beamten mit Ausnahme von RoboCop die normalen Körperverletzungsdelikte, wie sie für jedermann gelten. Schon für die einfache Körperverletzung, das kann eine Ohrfeige sein, können bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe verhängt werden. Handeln mehrere Täter gemeinsam oder ist ein gefährliches Werkzeug (bei Tritten reicht ein Turnschuh) im Spiel, gilt bereits heute eine Mindeststrafe von sechs Monaten. Die Maximalstrafe beträgt zehn Jahre Gefängnis. Bei schweren Taten, zum Beispiel wenn es zu bleibenden Schäden kommt, gelten Mindeststrafen von drei Jahren.
Die Strafen für Körperverletzungsdelikte sind vor Jahren in diversen Gesetzesnovellen verschärft worden. Aber nicht nur die Strafen gingen nach oben, es wurde auch die versuchte Körperverletzung unter Strafe gestellt.
Natürlich kann man der Meinung sein, das Strafmaß für das Grunddelikt, normalerweise die kurze Klopperei aus nichtigem Anlass, sei viel zu niedrig. Angesichts der geltenden Höchststrafe von fünf Jahren wird dieser Einwand aber eigentlich nur noch von Leuten erhoben, die der „Rübe für alles ab“-Fraktion angehören.
Polizisten sind also eigentlich gegen Gewalt geschützt, gut sogar. Die rechtliche Situation ist ganz anders, als sie im propagandistischen Sperrfeuer der Polizeigewerkschaften und der Innenminister dargestellt wird.
Somit stellt sich die Frage, wieso ausgerechnet die einfache Widerstandshandlung auf einmal härter und vor allem mit einer Mindest-, möglichst sogar mit einer Mindestfreiheitsstrafe bedroht werden soll. Mir fällt dazu eigentlich nur ein, dass die Anzeige wegen „Widerstand“ sehr häufig in Fällen kommt, in denen es Anhaltspunkte für nicht ganz astreines Verhalten einzelner Beamter gibt. Aus naheliegenden Gründen ist die Anzeige nach § 113 Strafgesetzbuch ein probates Mittel für die Vorwärtsverteidigung der Ordnungshüter. Aber auch wenn mutmaßliche Opfer von Pflichtverletzungen selbst Anzeige erstatten, kann mit dem Widerstandsargument trefflich Gegendruck erzeugt werden.
Die offiziellen Begründungen sind logisch nicht nachvollziehbar. Deshalb darf man wohl spekulieren, ob die Forderung nach härteren Strafen für einfache Widerstandshandlungen nicht in Wirklichkeit auf einen Respekts- und Maulkorbparagrafen abzielt. Auch wenn es natürlich keiner der Verantwortlichen zugibt – ganz so unplausibel wie die sonstigen Argumente ist dieses Anliegen sicher nicht.