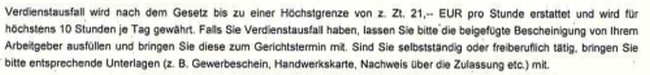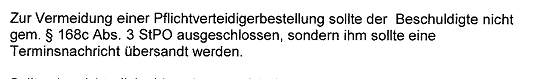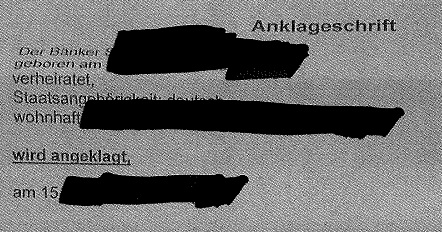Auf die Hauptuntersuchung am Auto dürfte sich jeder Autofahrer etwa so freuen wie auf einen Zahnarzttermin. Allerdings kann man sich vor dem TÜV nicht drücken, weshalb man vielleicht besser von einigen aktuellen Änderungen wissen sollte.
Weist das Auto Mängel auf, gibt es seit dem 20. Mai vier Kategorien. Bisher waren es nur drei („geringe Mängel“, „erhebliche Mängel“, „verkehrsunsicher“). Neu eingeführt wurde die Stufe „gefährliche Mängel“, die sich vor „verkehrsunsicher“ schiebt. Prüfer können diese Stufe wählen, wenn es trotz der Mängel noch vertretbar ist, dass der Wagen nach Hause oder in die Werkstatt bewegt wird. Sonstige Fahrten führen zu einem Bußgeld, wenn man erwischt wird.
Der Wagen muss innerhalb eines Monats repariert vorgeführt werden, dann gibt es auch eine neue Plakette. Gleiches gilt auch für die Vorstufe, die „erheblichen Mängel“. Auch hier ist man verpflichtet, den Wagen innerhalb eines Monats noch mal vorzuführen, darf bis zur Reparatur aber auch noch rumfahren. Nur bei den „geringen Mängeln“ (etwa eine defekte Lampe) wird dem Autofahrer die erneute Fahrt zum TÜV oder zu einem anderen Prüfer erspart.
Bei der Einstufung „verkehrsunsicher“ ändert sich nichts. Hier wird die Plakette abgekratzt, das Auto muss abgeschleppt werden.
Weiter neu ist seit dem 20. Mai, dass Prüfstellen auch die eingebauten Reifenkontrollsysteme (RDKS) checken. Funktioniert das System nicht oder ist es deaktiviert, darf keine Plakette erteilt werden. Außerdem nehmen die Prüfer künftig auch die Komponenten für Datenkommunikation und Datenspeicherung unter die Lupe. Dazu gehört insbesondere das eCall-Notrufsystem, das für seit April 2018 in Neuwagen eingebaut sein muss.