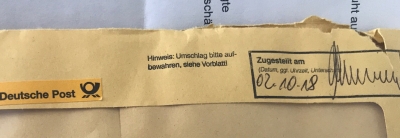Dass Berufungsgerichte die Strafe eines Angeklagten mildern, kommt täglich vor. Schon allein deswegen, weil eine Strafschärfung in der Regel ausgeschlossen ist. Der rechtliche Grundsatz nennt sich „reformatio in peius“. Eine härtere Strafe kann das Berufungsgericht nur verhängen, wenn auch die Staatsanwaltschaft zu Lasten des Angeklagten in Berufung gegangen ist – was allerdings relativ selten geschieht.
Schlagzeilen macht gerade ein Strafrabatt, den das Landgericht Zwickau gewährt haben soll. Die Strafe eines Algeriers, der in sieben Monaten sechs Straftaten begangen haben soll, wurde von dreieinhalb auf zwei Jahre gesenkt. Vorrangig, weil der Täter, der unter anderem einen Mann mit einem Messer erheblich verletzt haben soll, nun in der Berufungsinstanz seine Taten gestand.
Allerdings soll das Gericht die Strafe auch reduziert haben, weil beim Angeklagten eine „erhöhte Haftempfindlichkeit“ vorliege. Gegenüber einem Boulevardblatt soll der Richter diese Feststellung mit dem Hinweis erläutert haben, es gebe für den Angeklagten eine Sprachbarriere, da diesere kaum deutsch spreche.
Hier geht es um Fragen der Strafzumessung. Das ist ein ganz schwieriges, weil extrem schwammiges Gebiet. Die individuelle Strafe richtet sich nach der Schuld des Täters. Um diese Schuld zu bewerten, gibt § 46 StGB eine Gebrauchsanweisung. Diese beschränkt sich allerdings im Kern auf die Aufgabe, dass alle Umstände, die für und gegen den Täter sprechen, abgewogen werden müssen. Ansonsten nennt das Gesetz nur einen Beispielkatalog von Punkten, die insbesondere zu berücksichtigen sind. Die Motive des Täters etwa, die Art der Tatausführung, die Folgen der Tat.
Genannt werden aber auch die „persönlichen Verhältnisse“. Dazu gehört zunächst mal völlig zu Recht auch die Frage, wie der Verurteilte eine Haftstrafe erleben wird. Die individuelle „Haftempfindlichkeit“ spielt gerade bei Menschen eine Rolle, die zum Beispiel erstmals in den Bau gehen. Für denjenigen ist das natürlich ein größerer Kulturschock als für einen abgeklärten Wiederholungstäter.
Ein gutes Argument für die Verteidigung liefert die Haftempflichkeit gerade in den Fällen, wo jemand zum ersten Mal in Untersuchungshaft gekommen ist. Da lässt sich dann – meist nachvollziehbar – gut damit argumentieren, dass die U-Haft für praktisch jedermann ein brutaler Warnschuss ist mit der Folge, dass man es vielleicht doch noch mal bei einer Bewährungsstrafe belassen kann.
Dass ein Angeklagter der deutschen Sprache nicht mächtig ist, muss das Gericht zwar beachten, aber hieraus lässt sich nicht zwingend ein Strafrabatt ableiten. Die Urteile zu diesem Thema fordern in der Regel etwas mehr als bloße Sprachunkenntnis. Gut möglich aber, dass der Vorsitzende der Berufungskammer eben genau diese weiteren Umstände bejaht hat und sie in sein Urteil reinschreiben wird.
Festhalten lässt sich mangels Details momentan nur, dass die Frage nach der Haftempfindlichkeit keine abstruse Erfindung des Landgerichts Zwickau ist. Vielmehr gehört diese zu den (fast) unzähligen Faktoren, die das Gericht bei einer Urteilsfindung im Auge haben muss.
Vielleicht muss man auch sehen, dass der Richter der Vorinstanz in Sachsen als „beinhart“ gilt (Bericht) und auch schon mal mit legeren, man könnte auch sagen ausländerfeindlichen Sprüchen auffällt. Gut möglich also, dass das Landgericht nun ein übertrieben hartes Urteil lediglich aufs Angemessene reduziert hat.