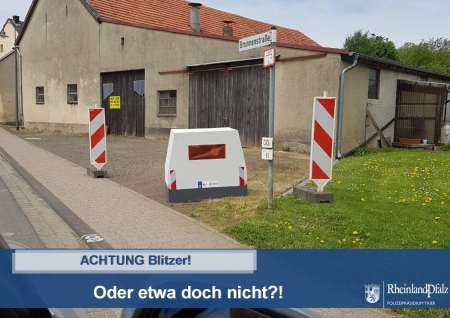Wenn es darum geht, der Staatskasse ein paar Euro zu ersparen und einen Anwalt mal so richtig schön vorzuführen, sind manche – zum Glück sehr wenige – Strafrichter um keinen Trick verlegen.
Einer dieser Tricks geht so: Nach den vielen, vielen Änderungen der Strafprozessordnung in den letzten Jahren gibt es nun auch die Möglichkeit für Zeugen, für die Dauer ihrer Vernehmung einen Anwalt als Beistand beigeordnet zu erhalten. Der Anwalt soll die schutzwürdigen Interessen des Zeugen wahrnehmen, ihn etwa über Zeugnis- und Auskunftsverweigerungsrechte belehren. Bezahlt wird der Anwalt aus der Staatskasse.
So eine Beiordnung hat diverse Voraussetzungen. Diese stehen in § 68b StPO, wobei hier nur die Einleitung von Absatz 2 des Paragrafen wichtig ist:
Einem Zeugen, der bei seiner Vernehmung keinen anwaltlichen Beistand hat …
Genau in diese Falle tappen Anwälte schon mal. Dabei machen sie eigentlich alles richtig. Sie melden sich schriftlich beim Gericht, beantragen auch ihre Beiordnung. Das Gericht reagiert aber nicht. Oder ganz fies, der Richter flötet am Telefon, die Frage der Beiordnung könne man doch direkt vor der Vernehmung des Zeugen in der Hauptverhandlung klären. Spart ja auch Papier und so.
Und was passiert? In der Verhandlung fragt der Richter den Staatsanwalt, ob dieser einer Beiordnung zustimmt. Der Staatsanwalt sagt: Nö. Durchaus zu Recht verweist der Staatsanwalt auf das Gesetz. Dieses regelt ja ausdrücklich (warum auch immer), dass einem Zeuge, der mit einem Anwalt zum Termin kommt und somit einen Zeugenbeistand hat, die Beiordnung nicht gewährt wird. So jedenfalls die weithin akzeptierte Auslegung.
Der erschienene Anwalt kann in der Situation auch nicht rausgehen nach dem Motto: Ohne Beiordnung arbeite ich nicht. Das wäre wohl eine Mandatskündigung zur Unzeit, wie es der Vertragrechtlicher formuliert. Also wird der Zeugenbeistand auch ohne Beiordnung seine Arbeit machen, weil er halt physisch anwesend ist. Eine nachträgliche Beiordnung gilt ohnehin als nicht zulässig und wird dementsprechend nicht gewährt.
Als Anwalt musst du also darauf achten, dass dich das Gericht frühzeitig ( = vor dem Gerichtstermin) als Zeugenbeistand für die Vernehmung beiordnet. Ist nicht sonderlich schwer, aber man muss diesen Punkt halt auf dem Schirm behalten.
Ein klein wenig verstimmt bin ich aber trotzdem. Schon wegen der bloßen Tatsache, dass es ein Richter aus Süddeutschland aktuell den Zeugenbeistands-Verweigerungs-Trick bei mir versucht hat, obwohl wir uns aus einem anderen Verfahren vor drei Jahren eigentlich kennen. Wobei es auf seiner Seite beim Versuch geblieben ist. Nach einem freundlichen Schreiben meinerseits war der Beiordnungsbeschluss heute in der Post.