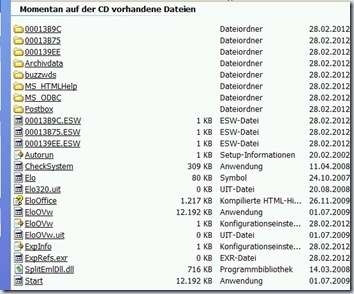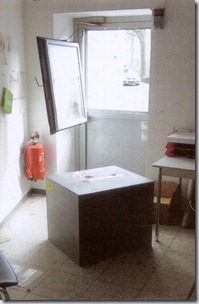Der Kampf eines Reutlinger Jugendrichters gegen Facebook ist nicht gerade ein Aushängeschild für die deutsche Justiz. So demonstriert man keine Schlagkraft. Das hatte ich schon neulich angemerkt. Nun geht die Sache weiter, und das Gericht macht dabei in bewährter Weise keine gute Figur.
Zuletzt hatte der Richter mangels eigener Erfolge die Idee entwickelt, der angeklagte Jugendliche solle sich seine Daten von Facebook selbst besorgen. Damit war der Betroffene, nach anfänglichem Zögern, auch einverstanden. Aber, oh Wunder, selbst der Angeklagte hatte bis zur jüngsten Verhandlung keine Post von Facebook gekriegt, wie der Reutlinger Generalanzeiger berichtet.
Eigentlich sollte der Richter fast froh darüber sein, dass Facebook auch seinem Nutzer bislang die kalte Schulter zeigt (wobei leider nicht berichtet wird, ob und was der Angeklagte wirklich bei Facebook eingefordert hat). Schließlich würde er ja noch düpierter da stehen, wenn das böse soziale Netzwerk ihn angeblich im Regen stehen lässt, seinen Nutzer aber prompt mit Daten bedient.
Anscheinend ist der Richter nach wie vor der Auffassung, er könne Facebook mit höflichen Mails zur Herausgabe von Kundendaten bewegen. Im eingangs verlinkten Artikel habe ich erklärt, warum das eine peinliche Selbstüberschätzung ist. Facebook verhält sich genau richtig, indem man dem Richter zwar mit “warmen Worten” antwortet, aber die Kundendaten nicht herausrückt. So ist nämlich die Rechtslage, auch wenn es für einen deutschen Richter schwer begreiflich sein mag, dass seine Macht an der bundesdeutschen Grenze endet.
Da hilft es dann auch nichts, wenn der Richter kokettiert. Indem er sich selbst als Vertreter der alten Dame Justitia darstellt, die sich nicht mit einem “Jugendlichen aus den USA” prügeln möchte. Offenbar scheint der Jugendrichter schlicht und einfach nicht zur Kenntnis nehmen zu wollen, dass er nur über die Einschaltung der irischen oder amerikanischen Behörden rechtmäßig an Auskünfte kommt. Auch wenn das, so ist es nun mal bei der internationalen Rechtshilfe, einige Zeit in Anspruch nimmt.
Stattdessen flüchtet sich der Richter in Aktionen, die wirklich daneben sind. So hat er nun eine Facebook-Lobbyistin als Zeugin geladen. Sofern sie in Deutschland lebt, wird sie bei Gericht erscheinen müssen.
Ebenso klar ist aber, was sie dem Richter sagen wird: Zu meinem Aufgabengebiet gehört nicht der Zugriff auf Nutzeraccounts. Zeugen müssen auch nur das aussagen, was sie wissen. Sie müssen sich kein neues Wissen beschaffen. Die Facebook-Mitarbeiterin wird also auch der Reutlinger Jugendrichter nicht dazu zwingen können, Daten zu besorgen, zu denen sie noch nicht mal Zugang hat.
Also schon jetzt eine vorhersehbar sinnlose Maßnahme. Nichts als ein Showeffekt, nach dessen Verpuffen mal wieder nicht Facebook düpiert sein wird, sondern unsere Justiz.