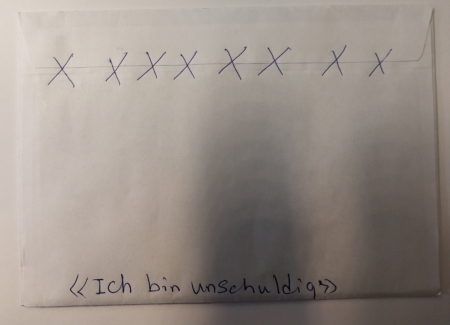Der „Idiotentest“ ist für Alkoholsünder eine gefürchtete, oft sogar unüberwindliche Hürde, wenn sie ihren Führerschein wiederbekommen wollen. Künftig wird das Ganze auf jeden Fall nicht einfacher – die maßgebliche Promillegrenze sinkt drastisch. Das Bundesverwaltungsgericht gibt in einem aktuellen Urteil den Straßenverkehrsämtern grünes Licht, wenn sie künftig schon ab 1,1 Promille einen Idiotentest verlangen.
Bislang lag die Grenze bei 1,6 Promille. Nur wer sich darüber getrunken hatte und dennoch am Steuer erwischt wurde, musste im Regelfall vor Wiedererteilung der Fahrerlaubnis die Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) bestehen. Nun kann diese Untersuchung schon ab 1,1 Promille verlangt werden, sofern die Polizei beim Alkoholsünder keine Ausfallerscheinungen festgestellt hat.
Die Betonung im letzten Satz liegt auf KEINE. Insoweit benutzt das Bundesverwaltungsgericht den von ihm entschiedenen Fall regelrecht als Steilvorlage. Ein Autofahrer hatte sich gegen die MPU-Anordnung gewehrt mit der Begründung, er habe lediglich 1,3 Promille im Blut gehabt – und überdies keinerlei Ausfallerscheinungen gezeigt. Die Polizei und der Arzt hatten bei der Verkehrskontrolle insoweit ausdrücklich festgehalten, dass der Alkoholkonsum dem Mann nicht anzumerken war.
Genau dieser Punkt, so das Bundesverwaltungsgericht, spreche aber für eine erhöhte „Giftfestigkeit“ des Betroffenen. Wer mit mehr als 1,1 Promille nach außen fit wirke und sich auch so fühle, müsse entsprechend alkoholgewöhnt sein. Das wiederum spreche dafür, dass der Betroffene zwischen Trinken und Fahren nicht mehr sicher trennen könne. In so einem Fall sei die MPU schon ab 1,1 Promille (Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit) zulässig.
Für Betroffene kann es im Bereich von 1,1 bis 1,6 Promille also künftig besser sein, wenn Polizei und Arzt festhalten, dass sie deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Möglicherweise wird dadurch vielleicht die Fahrerlaubnis etwas länger entzogen und die Strafe höher – aber es kommt noch nicht zur Anordnung der MPU. Andererseits kann es auch mächtig nach hinten losgehen, wenn man sich besoffener gibt, als man ist. Unterhalb der Grenzen 1,1 und insbesondere 0,5 Promille führen festgestellte Ausfallerscheinungen nämlich wieder zu juristischen Nachteilen in Form härterer Strafen und längerer Sperren.
Besonders spannend ist jetzt natürlich, wie die Straßenverkehrsämter reagieren. Bei noch laufenden Antragsverfahren auf Wiedererteilung der Fahrerlaubnis haben sie auf jeden Fall die höchstrichterliche Rückendeckung, nun auch standardmäßig im Bereich zwischen 1,1 und 1,6 Promille eine MPU zu verlangen. Damit könnten bundesweit auf viele hundert, wenn nicht tausende Betroffene schwere Zeiten zukommen (Aktenzeichen 3 C 3.20).