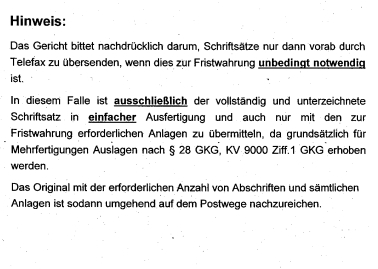Zu früh auf der sicheren Seite gewähnt hat sich heute morgen eine Staatsanwältin. Sie war meinem betagten Mandanten ins Wort gefallen, als er vor Gericht erzählte, welch gutes Verhältnis er zu seinen Kindern hat. Insbesondere zu seiner Tochter.
„Hoffen wir, dass Ihre Tochter Sie demnächst auch besucht, wenn Sie drinne sind.“
Nach Knast sah es auch geraume Zeit aus. Denn mein Mandant war nun schon das siebte Mal erwischt worden, wie er ohne Führerschein Auto gefahren ist. Die neueste Fahrt hat er ausgerechnet noch während laufender Bewährung gemacht. Auch wenn er mit der Justiz bisher nur wegen seines Hangs zum Autofahren Ärger hatte, war die Geduld der Strafrichterin dadurch natürlich schon extrem strapaziert.
Wir brachten wirklich alles vor, was die Tat in milderem Licht erscheinen lässt. Der Anklagevertreterin erschien die Beweisaufnahme sichtlich zu lang. Und insbesondere mein Plädoyer. Sie rollte mehrmals mit den Augen, als ich wirklich auch noch das pieseligste Argument brachte, welches für meinen Mandanten sprach. Allerdings war es offensichtlich kein Fehler, etwas weiter auszuholen. Das Gesamtbild, so formulierte es die Richterin später, reichte nämlich, um ihr Herz zu erweichen. Es gab zwar die unausweichliche Freiheitsstrafe. Aber halt auch noch mal Bewährung.
Zu einem Rechtmittelverzicht war die sichtlich erfreute Anklagevertreterin nicht bereit. Gut möglich also, dass sie Berufung einlegt und wir demnächst noch mal am Landgericht kämpfen dürfen. Aber wenn bis dahin nicht noch ein neuer Fall dazu kommt, dürfte auch noch die dann beachtliche Zeit zwischen Tat und Urteil als weiteres Argument hinzu kommen.
Sofern allerdings noch was passiert, ist der Ofen aus. Aber wer weiß – hatte ich das nicht innerlich auch schon für den heutigen Prozess gedacht?