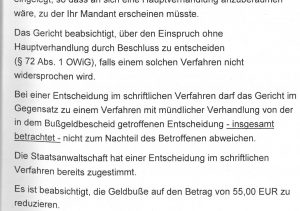Das Bundeskabinett hat einige Änderungen beschlossen, die das Leben von Radfahrern und Fußgängern sicherer machen sollen. Die wichtigsten Änderungen:
• Künftig gilt ein festgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 Meter innerorts und 2 Metern außerorts beim Überholen von Radfahrern.
• Auf Schutzstreifen für Radfahrer (rote Markierungen) gilt absolutes Halteverbot.
• Lkws über 3,5 Tonnen dürfen nach rechts nur noch mit Schrittgeschwindigkeit abbiegen.
• Für Radfahrer wird ein Grünpfeil eingeführt, der ausschließlich für sie gilt.
• Die Kommunen können Fahrradzonen einrichten.
Parallel dazu werden die einschlägigen Bußgelder drastisch erhöht. So kostet das Halten auf einem Schutzstreifen für Radfahrer künftig 100 Euro, das gilt auch für das Halten in zweiter Reihe. Auch die Geldbußen für das Parken auf Geh- und Radwegen wird drastisch erhöht. Bis zu 100 Euro kann das ebenfalls künftig kosten (statt bisher 15 Euro). Das hat wohl zur Folge, dass man künftig auch wegen „einfacher“ Parkverstöße Punkte in Flensburg kriegen kann, sofern das Bußgeld die Eintragungsgrenze von 60 Euro erreicht.
Die Regierung will den Bußgeldkatalog bis Frühjahr anpassen.