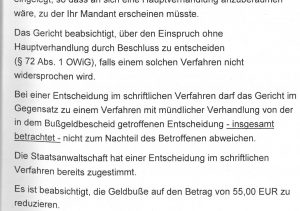Verhandlungen geraten mitunter in eine Sackgasse. Keine Seite sieht mehr eine Möglichkeit, sich zu bewegen. Das gilt – natürlich – auch im Strafprozess. Und auch hier ist es wichtig, mögliche Exit-Strategien zu kennen – um vielleicht doch wieder Bewegung in die Sache zu bringen.
In kleineren Fällen, in denen „nur“ eine Geldstrafe im Raum steht, gibt es zum Beispiel das Rechtsinstitut der „Verwarnung mit Strafvorbehalt“ (§ 59 StGB). Das ist an sich eine schöne Sache: Wenn es für eine Einstellung wegen geringer Schuld nicht reicht, aber auch eine Geldstrafe nicht sein muss, kann die Verhängung der Geldstrafe als solche zur Bewährung ausgesetzt werden. Die Strafe wird also nur wirksam, wenn der Angeklagte innerhalb der Bewährungszeit, die ein bis maximal zwei Jahre beträgt, sich erneut etwas zuschulden kommen lässt.
Der große Vorteil liegt insbesondere darin, dass die Verwarnung mit Strafvorbehalt nicht im Strafregisterauszug auftaucht (jedenfalls, wenn der Betroffene keine Vorbelastungen hat). Er behält also nach außen eine reine Weste, was ja heutzutage gar nicht überbewertet werden kann.
Seltsamerweise haben Richter und auch Staatsanwälte das Zwischending zwischen Einstellung und Strafe fast nie auf dem Schirm. Jedenfalls kann ich mich momentan nur an einen Fall erinnern, in dem der Richter eine Verwarnung mit Strafvorbehalt vorschlug. Wobei ich genau das ebenfalls gerade anregen wollte. Es ist also immer am Verteidiger oder auch am Angeklagten selbst, diesen Lösungsansatz ins Spiel zu bringen.
Vor kurzem habe ich in München mit der Idee eine ziemlich verfahrene Situation aufgelöst. Die Richterin war zuerst skeptisch, ließ sich dann aber davon überzeugen, dass man doch von den Möglichkeiten des Gesetzes auch Gebrauch machen sollte, wenn es sich anbietet. Auch der Staatsanwalt konnte seinem Credo treu bleiben, dass er einer Einstellung wegen geringer Schuld nie und nimmer zustimmt.
Am Ende waren alle froh, auch wenn die Sache sich dann noch eine knappe Stunde in die Länge zog. Die Richterin musste erst mal die nötigen Formulare suchen und ausdrucken, weil sie offensichtlich gar nicht wusste, wie man eine Verwarnung mit Strafvorbehalt korrekt formuliert.
Wenn ihr mal Ärger habt, denkt vielleicht an diese Möglichkeit. Und stupst euren Anwalt an, die Idee wird ihm sicher gefallen.