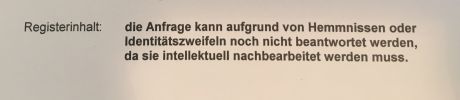Die Arbeit bei vielen Staatsanwaltschaften ist ein Fließbandgeschäft. Das merkt man jedenfalls bei den „kleinen“ Fällen, die nach Schema F abgearbeitet werden können. Was da nicht der vorgegebenen Logik genügt, kann sich schnell zum juristischen Ausreißer entwickeln.
Nehmen wir den Fall eines kleinen Arbeitgebers. Der beschäftigte einen Arbeiter. Er zahlte den im Arbeitsvertrag vereinbarten Lohn. Die Abgaben für die Sozialkasse führte er ordnungsgemäß ab. Nach einigen Monaten begann ein Streit, ob dem Arbeiter nicht mehr Geld zusteht. Weil möglicherweise ein Tarifvertrag anwendbar ist.
Die Sache ging vors Arbeitsgericht und dümpelte dort lange rum. Die zuständige Richterin war in Elternzeit, mit dem Ersatz klappte es wohl nicht so recht. Jedenfalls ging so viel Zeit ins Land, dass dem verärgerten Arbeitnehmer bzw. dessen Anwalt der Kragen platzte. Sie schoben noch eine Strafanzeige hinterher, in der sie „Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt“ (§ 266a StGB) beklagten. Und zwar für den ganzen Zeitraum, in dem der Arbeiter nach wie vor nur sein vereinbartes Gehalt und nicht den Tariflohn bekommen hat.
Irgendwann war die Richterin wieder da. Ihr Urteil erklärte den Tarifvertrag für anwendbar. Sie verurteilte den Arbeitgeber zur Nachzahlung. Die dieser auch leistete. Und die Staatsanwaltschaft? Die schreibt dem Arbeitgeber, gegen ihn bestehe nun der „ausreichende“ Verdacht, Arbeitnehmeranteile an den Sozialabgaben für das vom Gericht festgestellte Arbeitsentgelt nicht rechtzeitig abgeführt zu haben, und zwar „zu den Fälligkeitsterminen im Beschäftigungszeitraum“.
Also mal ehrlich. Auch einem gestressten Staatsanwalt sollte doch auffallen, dass eine rückwirkende Verurteilung zu einer bis dahin arbeitsvertraglich streitigen Lohnzahlung nicht bedeutet, dass damit auch die Sozialabgaben rückwirkend fällig werden. Das würde ja bedeuten, dass der Arbeitgeber zwar der Meinung sein darf, er schulde den Lohn nicht, gleichwohl muss er aber schon mal vorsorglich die Arbeitnehmeranteile abführen. So streng ist das System dann aber doch nicht.
Das einzig richtige Ergebnis wäre also spätestens jetzt, das Ermittlungsverfahren mangels Tatverdachts einzustellen. Stattdessen bietet der Staatsanwalt zwar die Einstellung an, aber nur, wenn mein Mandant als Auflage einen schönen Batzen Geld für die Staatskasse locker macht.
Wir werden wohl dankend ablehnen. Vielleicht schaut der Staatsanwalt ja doch noch mal richtig in seine Akte. Bei einem Telefonat, das ich vorhin mit ihm führte, hatte ich jedenfalls nicht den Eindruck, dass er die auch nur ansatzweise kennt.